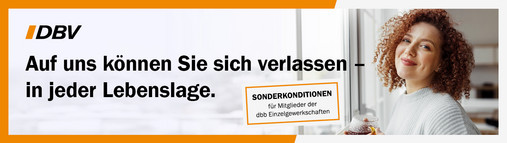-
 Auf der einen Seite stehen die Gewerkschaften, auf der anderen die Arbeitgebenden: Der Ablauf einer Tarifverhandlung hängt davon ab, wie schnell sich die Tarifparteien einigen. Foto: Colourbox/wer
Auf der einen Seite stehen die Gewerkschaften, auf der anderen die Arbeitgebenden: Der Ablauf einer Tarifverhandlung hängt davon ab, wie schnell sich die Tarifparteien einigen. Foto: Colourbox/wer
Kurz erklärt Ablauf einer Tarifverhandlung – alle Schritte bis zum Abschluss
Tarifverhandlungen folgen, wenn man so will, einer bestimmten Choreografie. Der Ablauf im Überblick.
Ablauf einer Tarifverhandlung
6. Die Einigung
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst profitieren von Tarifverträgen, die Klarheit und Sicherheit schaffen. Sie regeln unter anderem Bezahlung, Arbeitszeit und Urlaubsanspruch rechtsverbindlich. Um Verbesserungen zu erzielen, führen Gewerkschaften regelmäßig Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebenden.
Die eigentlichen Verhandlungen sind nur ein Teil des gesamten Ablaufs, zu dem noch viele weitere Schritte gehören können. Den gesamten Prozess, in dessen Verlauf Tarifparteien über einen Tarifvertrag verhandeln, bezeichnet man als Tarifrunde.
1. Die Protagonisten
Tarifparteien sind alle, die unmittelbar an den Tarifverhandlungen beteiligt sind. Auf der einen Seite stehen die Arbeitgebenden – sie können einzeln in Erscheinung treten oder als Arbeitgeberverbände. Ihnen gegenüber stehen die Gewerkschaften, die sich für die Interessen der Arbeitnehmenden einsetzen. In Deutschland herrscht Tarifautonomie. Das bedeutet: Beide Seiten können frei über Arbeitsbedingungen und Entgelte verhandeln, ohne dass der Staat sich einmischt.
Für den öffentlichen Dienst gelten verschiedene Tarifverträge. Es gibt Manteltarifverträge, die unter anderem Arbeitszeit und Urlaub regeln. Die Entgelte können Tarifparteien in sogenannten Entgelttarifverträgen gesondert vereinbaren oder als Teil eines Manteltarifvertrags. Letzteres ist im öffentlichen Dienst überwiegend der Fall.
2. Die Voraussetzungen
Tarifparteien können bereits einen Folgevertrag verhandeln, während der aktuelle noch gültig ist. Weitere Szenarien sind, dass es noch keinen Tarifvertrag gibt oder ein bestehender ausgelaufen ist.
In einem Tarifvertrag können Vereinbarungen stehen, die nicht automatisch auslaufen. Diese müssen Gewerkschaften aktiv kündigen. Das Ende der Laufzeit markiert den frühestmöglichen Zeitpunkt der Kündigung. Vor Beginn einer Tarifrunde kündigen die Gewerkschaften die Bestandteile eines Tarifvertrags, über die sie neu verhandeln möchten. Auch die Arbeitgebenden können einzelne Bestandteile oder gesamte Tarifverträge kündigen, um mit den Gewerkschaften zu verhandeln.
3. Die Forderungen
Bezahlung, Arbeitszeit, Urlaubstage: Die Forderungsfindung und der Forderungsbeschluss erfolgen in der sogenannten Tarifkommission einer Gewerkschaft. Dabei handelt es sich um ein Gremium, das Tarifverhandlungen vorbereitet, führt und über die Ergebnisse entscheidet. Sind mehrere Gewerkschaften an einer Tarifrunde beteiligt, stimmen sich ihre jeweiligen Tarifkommissionen ab. Beim dbb beamtenbund und tarifunion entscheidet in der Regel die Bundestarifkommission.
Wenn ein Forderungsbeschluss vorliegt, machen die Gewerkschaften ihre Forderungen öffentlich. Dies muss nicht zwingend nach dem Ende der Laufzeit des aktuell gültigen Tarifvertrags erfolgen – in vielen Fällen findet die Forderungsverkündung sogar davor statt.
4. Die Verhandlungen
Meistens gibt es mehrere Verhandlungsrunden. Die Termine können die Tarifparteien im Voraus abstimmen. Das ist kein Muss, aber bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst üblich. Wenn erforderlich, lassen sich kurzfristig weitere Termine ergänzen.
Der Verlauf einer Tarifverhandlung hängt davon ab, wie die Gespräche zwischen den Tarifparteien vorankommen. Mit den erfolgten Kündigungen, die Teile des zu verhandelnden Tarifvertrags berühren, und nach Ablauf der Kündigungsfrist ist auch die Friedenspflicht erloschen. Heißt: Die Gewerkschaften können Warnstreiks organisieren, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Zeichnet sich ab, dass die Arbeitgebenden die Forderungen nicht erfüllen wollen, können Gewerkschaften und Arbeitgebende die Tarifverhandlungen für gescheitert erklären und zu unbefristeten Streiks aufrufen. Ob sie bereit sind, in einen unbefristeten Streik zu treten, darüber entscheiden die Gewerkschaftsmitglieder in einer sogenannten Urabstimmung.
5. Die Schlichtung
Wie geht es wieder zurück an den Verhandlungstisch? Mit Warnstreiks und unbefristeten Streiks wollen die Gewerkschaften erreichen, dass die Arbeitgebenden ein verbessertes Angebot vorlegen. Grundsätzlich können beide Seiten auch eine Schlichtung vorschlagen. Sie erfolgt allerdings nur, wenn alle Tarifparteien zustimmen – es sei denn, sie haben vorab eine Schlichtungsvereinbarung getroffen.
Besteht eine Schlichtungsvereinbarung und ruft eine Tarifpartei die Schlichtung an, ist in diesem Fall auch die andere verpflichtet, sich auf das Verfahren einzulassen. Dabei vermittelt eine paritätisch von Arbeitgebenden und Gewerkschaften besetzte Schlichtungskommission, die am Ende eine Einigungsempfehlung abgibt, in den Medien oft auch „Schlichterspruch“ genannt. Die Tarifparteien sind nicht zur Zustimmung verpflichtet. Sie verhandeln anschließend auf Basis des Schlichterspruchs weiter.
Während einer Schlichtung gilt erneut die Friedenspflicht.
6. Die Einigung
Sind die Verhandlungen erfolgreich, steht eine Tarifeinigung. Diese halten die Tarifparteien in der Regel schriftlich fest. Der neue Tarifvertrag wird anschließend in der sogenannten Redaktion ausformuliert, was einige Monate in Anspruch nehmen kann. Die Einigung gilt erst als rechtsverbindlich, wenn der neue Tarifvertrag vorliegt und unterschrieben ist. Die vereinbarte Laufzeit gilt immer rückwirkend zum vergangenen Kündigungsdatum.
Mehr entdecken: Entgelttabellen im öffentlichen Dienst – so liest du sie richtig
Übrigens: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ist es für den dbb beamtenbund und tarifunion mit dem rechtsverbindlichen Tarifvertrag, der lediglich die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst betrifft, noch nicht getan. Die Gewerkschaft setzt sich dafür ein, dass der zuständige Gesetzgeber das Tarifergebnis auch auf die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen überträgt, sodass alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst profitieren. Deshalb spricht der dbb im konkreten Fall auch nicht von einer Tarifrunde, sondern von einer Einkommensrunde, die diesen letzten Schritt einschließt.
Was sind mögliche Ergebnisse von Tarifverhandlungen?
- Eine lineare Erhöhung ist eine prozentuale Erhöhung des Entgelts, deren Umsetzung in der Regel gestaffelt erfolgt. Die Zeitpunkte der Erhöhungen sind genau festgelegt.
- Ein Sockelbetrag bewirkt, dass niedrige Entgeltgruppen stärker profitieren. Anstelle einer prozentualen Erhöhung oder ergänzend zu dieser Erhöhung vereinbaren die Tarifparteien einen bestimmten Betrag, um den das Entgelt zu einem bestimmten Zeitpunkt steigt.
- Mindestbeträge sind eine weitere Option, um für niedrige Entgeltgruppen bessere Abschlüsse zu erreichen. Denn selbst hohe prozentuale Entgelterhöhungen bedeuten nicht zwingend spürbar mehr Geld. Ein vereinbarter Mindestbetrag hat Priorität gegenüber einer vereinbarten linearen Erhöhung.
- Mit Leermonaten ist der Zeitraum gemeint, in dem keine Entgelterhöhung erfolgt. Um Kosten zu sparen, haben die Arbeitgebenden großes Interesse daran, dass zwischen einem ausgelaufenen beziehungsweise gekündigten Tarifvertrag und der ersten anteiligen Entgelterhöhung möglichst viel Zeit verstreicht. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass die Tarifeinigung bestenfalls keine oder nur wenige Leermonate umfasst.
- Die Tarifparteien vereinbaren eine Laufzeit – einen Zeitraum, in dem der Vertrag gültig und nicht kündbar ist. Während der Laufzeit besteht Friedenspflicht, Streiks sind nicht erlaubt.
- Gegenstand der Tarifverhandlungen sind oft auch Regeln für die Übernahme von Auszubildenden, Prämien und Zulagen, die bestimmte Sparten im öffentlichen Dienst betreffen.
- Zulagen können dynamisch sein. Das bedeutet: Die Zulage ist an die lineare Entwicklung der Tabellenentgelte gekoppelt. Wenn die Entgelte steigen, steigen folglich auch die Zulagen.
Redaktion: cdi