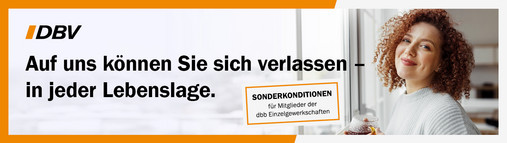-
 Ob sie wollen oder nicht: Die Friedenspflicht ist für die Tarifparteien unter bestimmten Voraussetzungen bindend. Foto: Colourbox/wer
Ob sie wollen oder nicht: Die Friedenspflicht ist für die Tarifparteien unter bestimmten Voraussetzungen bindend. Foto: Colourbox/wer
Kurz erklärt Was bedeutet Friedenspflicht?
Egal, ob während der Laufzeit, Tarifverhandlungen oder Schlichtung: Bei Missachtung der Friedenspflicht drohen Konsequenzen.
Friedenspflicht bedeutet, dass Tarifpartner – also Gewerkschaften und Arbeitgebende – unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sind, auf Arbeitskampfmaßnahmen zu verzichten. Im Fall der Gewerkschaften sind das zum Beispiel Warnstreiks und unbefristete Streiks. Und im Fall der Arbeitgebenden die sogenannte Aussperrung, bei der sie Beschäftigten den Zugang zum Arbeitsplatz verwehren.
Unter welchen Voraussetzungen die Friedenspflicht gilt, kann von Vereinbarungen abhängen, die Tarifparteien in einem Tarifvertrag oder in einer Schlichtungsvereinbarung beschließen. Es gibt aber auch allgemeingültige Voraussetzungen, die keine gesonderte Vereinbarung erfordern.
Wenn die Gegenseite gegen die Friedenspflicht verstößt, können Gewerkschaften und Arbeitgebende vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken. Gibt das Gericht dieser statt, sind alle Arbeitskampfmaßnahmen umgehend einzustellen, weil sie rechtswidrig sind.
Friedenspflicht während der Laufzeit
In der Regel vereinbaren Tarifparteien für einen Tarifvertrag und für bestimmte Inhalte eines Tarifvertrags eine Laufzeit. Diese Absprachen können Gewerkschaften und Arbeitgebende zum Ende der Laufzeit kündigen.
Für alle Absprachen, die tariflich geregelt sind, gilt automatisch die sogenannte relative Friedenspflicht. Das bedeutet: Wenn die Tarifparteien etwa eine bestimmte Bezahlung für die Beschäftigten im Tarifvertrag vereinbart haben, dürfen sie während der Laufzeit keine Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen, um Änderungen an dieser Bezahlung zu erwirken. Mit Blick auf andere Themen, die nicht Gegenstand des Tarifvertrags sind, hingegen schon. Deshalb ist die Friedenspflicht in diesem Fall relativ. Demonstrationen sind immer möglich, sie bleiben von der Friedenspflicht unberührt.
Ein Beispiel aus der Praxis: Im Oktober 2025 traten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hamburg für eine Zulage in den Warnstreik. Dies war rechtlich möglich, weil in dem für Hamburg gültigen Tarifvertrag der Länder (TV-L) zu diesem Zeitpunkt keine tarifliche Vereinbarung dieser Zulage bestand.
Darüber hinaus gibt es die absolute Friedenspflicht, mit der sich die Tarifparteien verpflichten, während der Laufzeit auf sämtliche Arbeitskampfmaßnahmen zu verzichten. Sie ist keinem Tarifvertrag immanent und muss ausdrücklich vereinbart werden. Die drei großen Flächentarifverträge für den öffentlichen Dienst (TVöD, TV-L, TV-H) beinhalten keine entsprechenden Vereinbarungen – sonst wäre die besagte Demonstration in Hamburg nicht möglich gewesen.
Friedenspflicht während Tarifverhandlungen
Die Gewerkschaften haben einen Tarifvertrag oder bestimmte Vereinbarungen in einem Tarifvertrag gekündigt, die Friedenspflicht endet mit dem Ende der Laufzeit, die Tarifverhandlungen beginnen: Um ihre Forderungen zu untermauern, gehen die Beschäftigten auf die Straße, planen Aktionen und demonstrieren. Gewerkschaften dürfen mit dem Ende der Friedenspflicht nun auch zu befristeten Warnstreiks aufrufen, um den Druck auf die Arbeitgebenden zu erhöhen.
In den unbefristeten Streik können die Beschäftigten nicht ohne Weiteres treten. Dies setzt voraus, dass eine Tarifpartei die Verhandlungen offiziell für gescheitert erklärt. Hinzu kommt, dass unter den Gewerkschaftsmitgliedern eine Urabstimmung für einen unbefristeten Streik stattfinden muss. Diese ist erfolgreich, wenn sich mindestens 75 Prozent der Stimmberechtigten, die ihre Stimme abgegeben haben, dafür aussprechen.
Friedenspflicht während der Schlichtung
Kommt es in einer Tarifrunde zur Schlichtung, so gilt für die Zeit der Schlichtung erneut die Friedenspflicht. Die Tarifparteien verzichten auf sämtliche Arbeitskampfmaßnahmen, um eine Einigung zu ermöglichen. Dies ist zumindest ein gängiges Szenario.
Mehr entdecken: Was bedeutet Tarifautonomie?
Es gibt jedoch kein Gesetz, dass die Friedenspflicht während einer Schlichtung vorschreibt. Sie ergibt sich aus Vereinbarungen, welche die Tarifparteien treffen, beispielsweise in einer Schlichtungsvereinbarung.
Diese ist kein Automatismus: Zwischen dem dbb beamtenbund und tarifunion, dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) besteht eine Schlichtungsvereinbarung. Sie gilt bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), mit der die Gewerkschaft den Tarifvertrag für den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder verhandelt, existiert hingegen keine entsprechende Absprache – und damit auch keine Regelung zur Friedenspflicht während einer möglichen Schlichtung, auf die sich die Tarifparteien überhaupt erst verständigen müssten.
Redaktion: cdi