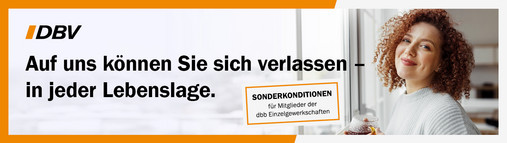-
 Was alle Entgelttabellen im öffentlichen Dienst eint: Nach bestimmten Zeiträumen bekommen Beschäftigte automatisch mehr Geld, ohne dass sie dafür verhandeln müssen. Foto: Colourbox/wer
Was alle Entgelttabellen im öffentlichen Dienst eint: Nach bestimmten Zeiträumen bekommen Beschäftigte automatisch mehr Geld, ohne dass sie dafür verhandeln müssen. Foto: Colourbox/wer
Kurz erklärt Entgelttabellen im öffentlichen Dienst – so liest du sie richtig
Aufbau, Gruppen, Stufen: Grundsätzlich ähneln sich Entgelttabellen im öffentlichen Dienst. Doch es gibt auch Unterschiede.
Egal, ob in Verwaltung, in der Sozialen Arbeit oder in der Pflege: Was sie verdienen, können Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst in Entgelttabellen nachlesen. Dabei handelt es sich um Übersichten, die regelmäßig aktualisiert werden. Zum Beispiel, wenn Tarifverhandlungen stattgefunden haben oder eine Entgelterhöhung ansteht. Es lohnt sich also, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Grundsätzlich besteht eine Entgelttabelle – wie jede übliche Tabelle – aus Spalten, Zeilen und Zellen. In der ersten Spalte stehen die Entgeltgruppen, darauf folgen weitere Spalten, in denen jeweils die Erfahrungsstufen von links nach rechts angeordnet sind. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Entgeltgruppe und der Erfahrungsstufe. Sie ist in den einzelnen Zellen nachzulesen.
Die aktuellen Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst veröffentlicht der dbb beamtenbund und tarifunion.
Was ist eine Entgeltgruppe?
Entgeltgruppen sind Kategorien, denen Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst zugeordnet werden. Diese Zuordnung bezeichnet man als Eingruppierung. Sie ergibt sich aus der Qualifikation und Tätigkeit. Als Faustregel gilt: Je höher der Bildungsabschluss und die Verantwortung, die mit der Tätigkeit einhergeht, desto höher die Entgeltgruppe.
Die Anzahl der Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst kann sich – abhängig von Tarifvertrag und Entgelttabelle – unterscheiden. Beispielsweise umfasst die Entgelttabelle für die Beschäftigten des Bundes (TVöD) 15 Entgeltgruppen. Diese spiegeln die Qualifikation wider, die mit den Tätigkeiten einhergeht.
- E1 bis E4: Tätigkeit ohne formale Qualifikation
- E5 bis E8: Tätigkeit mit abgeschlossener Berufsausbildung
- E9 bis E12: Tätigkeit mit Fachhochschul- oder Bachelorabschluss
- E12 bis E15: Tätigkeit mit Masterabschluss oder Promotion
Das Prinzip lässt sich auf Entgelttabellen übertragen, die eine andere Anzahl an Entgeltgruppen umfassen. Wer sich weiterbildet oder höherwertige Tätigkeiten übernimmt, kann in höhere Entgeltgruppen aufsteigen.
Aufgepasst bei der Benennung!
Je nach Entgelttabelle heißen die Entgeltgruppen anders. In den allgemeinen Entgelttabellen des TVöD, TV-L und TV-H haben sich die Kürzel „EG“ und „E“ etabliert. In den Tabellen für den Sozial- und Erziehungsdienst erfolgt die Bezeichnung mit „S“, in denen für die Pflege mit „P“ (TVöD) oder „Kr“ (TV-L; „Kr“ steht für „Krankenhaus“).
In den Entgelttabellen für die Beschäftigten bei der Bundesagentur für Arbeit ist von Tätigkeitsebenen die Rede, abgekürzt mit „TE“. Hier gilt, anders als bei den anderen Entgelttabellen: Je höher die Zahl, desto niedriger die Entgeltgruppe. Die niedrigste Entgeltgruppe ist die TE VIII, die höchste die TE I. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
Welche Besonderheiten gibt es bei den Entgeltgruppen?
In manchen Entgeltgruppen steht ein „Ü“. Der Buchstabe steht in diesem Fall für „Überleitung“.
Ein Beispiel: Im TVöD gibt es die Entgeltgruppen 15 und 15Ü. Das ist eine Folge der Einführung des TVöD, der im Jahr 2005 den Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT) ablöste. Für die höchste Vergütungsgruppe im BAT gab es keine Entsprechung mehr im TVöD. Deshalb wurden die dort eingruppierten Beschäftigten in die Entgeltgruppe Ü15 übergeleitet. Ähnlich verhält es sich auch mit der Entgeltgruppe 2Ü (ebenfalls TVöD).
Für alle, die neu in den öffentlichen Dienst starten, sind die Ü-Entgeltgruppen nicht von Bedeutung. In ihrem Fall erfolgt keine Eingruppierung in diese Entgeltgruppen.
Manche Entgeltgruppen gliedern sich weiter in Untergruppen auf. Beispielsweise unterscheidet der TV-L zwischen den Entgeltgruppen 9a und 9b.
Der TV-L wurde im Jahr 2006 eingeführt und damit auch die (inoffiziell) sogenannte „kleine EG 9“ und „große EG 9“, die für bestimmte Beschäftigtengruppen unterschiedliche Stufenanzahlen und Stufenlaufzeiten vorsahen. Dies beruhte auf der zuvor gängigen Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte. Einige Jahre später schafften die Verantwortlichen die unterschiedlichen Stufenanzahlen und Stufenlaufzeiten ab und etablierten die Unterscheidung zwischen 9a und 9b.
Mehr entdecken: Wer bekommt was? Jahressonderzahlungen im öffentlichen Dienst
Im Kern ermöglichen die Untergruppen, verschiedene Anforderungen innerhalb einer Entgeltgruppe bei der Eingruppierung genauer zu berücksichtigen. Sie findet sich auch in anderen Entgelttabellen. In manchen Fällen erfolgen nicht nur Unterscheidungen zwischen a und b, sondern auch zwischen a, b und c.
Was ist eine Erfahrungsstufe?
Erfahrungsstufen sind Gehaltsstufen innerhalb einer Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst, die vor allem die Berufserfahrung abbilden. Mit zunehmender Berufserfahrung steigen die Beschäftigten in höhere Erfahrungsstufen auf. Dies passiert nach bestimmten Zeiträumen automatisch; Verhandlungen sind nicht erforderlich.
Die meisten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst haben sechs Erfahrungsstufen. Im Regelfall erfolgt der Stufenaufstieg nach dem folgenden Muster:
- Der Aufstieg in Stufe 2 erfolgt nach einem Jahr in Stufe 1
- Der Aufstieg in Stufe 3 erfolgt nach zwei Jahren in Stufe 2.
- Der Aufstieg in Stufe 4 erfolgt nach drei Jahren in Stufe 3.
- Der Aufstieg in Stufe 5 erfolgt nach vier Jahren in Stufe 4.
- Der Aufstieg in Stufe 6 erfolgt nach fünf Jahren in Stufe 5.
Wer neu in den öffentlichen startet und bereits Berufserfahrung mitbringt, muss nicht zwingend mit der niedrigsten Erfahrungsstufe einsteigen. In der Regel wird die vorhandene Berufserfahrung berücksichtigt.
Übrigens: Die allgemeine Entgelttabelle für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen (TV-H) unterscheidet zwischen den Erfahrungsstufen 1a und 1b. Hintergrund sind Laufzeiten innerhalb der Erfahrungsstufe, in diesem Fall betragen sie jeweils sechs Monate. Heißt: Bereits nach einem halben Jahr bekommen Tarifbeschäftigte in Hessen mehr Geld, wenn sie in die Stufe 1b aufsteigen.
Redaktion: cdi