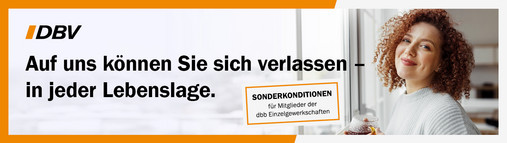-
 7 Prozent mehr Einkommen, mindestens jedoch 300 Euro – so lautet die Kernforderung der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen TV-L 2025. Foto: Colourbox/wer
7 Prozent mehr Einkommen, mindestens jedoch 300 Euro – so lautet die Kernforderung der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen TV-L 2025. Foto: Colourbox/wer
TV-L 2025 Ablauf, Forderungen, Termine – alle Infos zur Einkommensrunde mit den Ländern
Mitunter ist die Orientierung in den Tarifverhandlungen TV-L 2025 gar nicht so einfach. Ein Überblick.
7 Prozent, mindestens jedoch 300 Euro mehr Einkommen – so lautet die Kernforderung der Gewerkschaften für die Einkommensrunde der Länder. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr bekommen. „Die jungen Menschen sind die Zukunft des öffentlichen Dienstes“, sagt Matthäus Fandrejewski, Vorsitzender der dbb jugend. „Ohne Nachwuchskräfte haben Schulen, Polizei und Verwaltung keine Zukunft. Der öffentliche Dienst muss konkurrenzfähig sein, um sich in Zeiten des Fachkräftemangels gegen die Privatwirtschaft durchzusetzen. Deshalb sind unsere Forderungen mehr als berechtigt.“
Wahlmodell: Deutschlandticket oder Tankzuschuss
Weiterhin erwarten die Gewerkschaften einen Mobilitätszuschuss für junge Beschäftigte. Auszubildende, Studierende und Praktikant*innen sollen sich zwischen einem Deutschlandticket oder einem Tankzuschuss in Höhe von 50 Euro entscheiden können. Fandrejewski: „Die Kosten für Mobilität sind massiv gestiegen. Sie dürfen nicht dazu führen, dass sich junge Fachkräfte gegen den öffentlichen Dienst entscheiden. Hier muss ein Mobilitätszuschuss Abhilfe schaffen.“
Der Chef der dbb jugend verweist nicht zuletzt auf das Problem der unterschiedlichen Bezahlung in Bund, Ländern und Kommunen. Dies gilt vor allem mit Blick auf Pflegeberufe und den Straßenverkehrsdient. „Unterschiedliche Tarife in Bund und Ländern bewirken, dass Fachkräfte dorthin wechseln, wo sie für dieselbe Tätigkeit mehr Geld bekommen“, sagt er. „Um diesen Effekt zu unterbinden, setzen wir uns für die Angleichung der Ländertarife an die Bundestarife ein. Das Credo muss lauten: Gleiches Geld für gleiche Arbeit!“
Untenstehend findest du alle Forderungen und Erwartungen der Gewerkschaften für junge Menschen im öffentlichen Dienst im Detail.
Wie lauten die Forderungen der Gewerkschaften?
Die Kernforderungen:
- Erhöhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten um 7 Prozent, mindestens aber 300 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
- Erhöhung der Zeitzuschläge gemäß § 8 Abs. 1 TV-L um jeweils 20 Prozentpunkte und Errechnung auf der Basis der individuellen Stufe, mindestens jedoch der Stufe 3.
- Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, Studierenden, Praktikantinnen und Praktikanten um 200 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
Forderungen für Auszubildende und Studierende:
- Übernahme der Auszubildenden und Dualstudierenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung unbefristet und in Vollzeit im erlernten Beruf.
- Tarifierung der Arbeitsbedingungen der studentischen Beschäftigten, insbesondere: einheitliches Mindeststundenentgelt von 17 Euro im ersten Beschäftigungsjahr, 18 Euro im zweiten Beschäftigungsjahr und 19 Euro ab dem dritten Beschäftigungsjahr (Beginn ab dem ersten Arbeitsvertrag); Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten für jeden einzelnen Vertrag; Mindeststundenumfang von 40 Stunden pro Monat (Unterschreitung nur auf Antrag der Beschäftigten)
Erwartungen für Auszubildende, Studierende und Praktikant*innen:
- Übernahme in Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
- Mobilitätszuschuss als Wahlmodell: Übernahme des Deutschlandtickets oder Tankkostenzuschuss in Höhe von 50 Euro
- Tarifierung der paxisintegrierten Dualstudierenden
Über weitere Erwartungen informiert der dbb beamtenbund und tarifunion.
Um welche Tarifverträge geht es?
Die Tarifparteien verhandeln über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Dieser umfasst eine allgemeine Entgelttabelle, außerdem Entgelttabellen für Beschäftigte im Pflegedienst (Kr-Tabelle) und im Sozial- und Erziehungsdienst (S-Tabelle).
Für die Nachwuchskräfte der Länder gibt es eigene Tarifverträge, die ebenfalls verhandelt werden. Das sind:
- TVA-L BBiG (Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz)
- TVA-L Pflege (Auszubildende in der Pflege)
- TVA-L Gesundheit (Auszubildende in Gesundheitsberufen)
- TVdS-L (Dualstudierende)
- TV Prakt-L (Praktikant*innen)
Hessen hat einen eigenen Tarifvertrag (TV-H). Dieser ist nicht Gegenstand der Verhandlungen.
Wen betrifft die Einkommensrunde der Länder?
Insgesamt sind die Tarifverhandlungen für etwa 3,5 Millionen Menschen von Bedeutung: Direkt betroffen sind die Entgelte von etwa 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten in 15 Bundesländern – indirekt die Besoldungen von etwa 1,4 Millionen Beamt*innen der Länder und Kommunen, auf die das Tarifergebnis übertragen werden soll. Übertragen werden soll das Ergebnis auch auf rund eine Million Versorgungsempfänger*innen.
Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen sind indirekt betroffen, weil die Übertragung nicht Gegenstand der Tarifverhandlungen ist. Diese müssen die einzelnen Landesparlamente per Gesetz beschließen.
Wer verhandelt den TV-L 2025?
Der dbb beamtenbund und tarifunion (dbb) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) vertreten die Seite der Arbeitnehmenden. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vertritt die Seite der Arbeitgebenden.
Wann finden die Tarifverhandlungen über den TV-L 2025 statt?
Aktuell sind drei Verhandlungsrunden vorgesehen. Dies sind die Termine:
- 3. Dezember 2025
- 15./16. Januar 2026
- 11./13. Februar 2026
Was passiert, wenn nach den vorgesehenen Verhandlungsrunden keine Einigung steht?
Für die Tarifrunde der Länder gibt es keine Schlichtungsvereinbarung. Wenn sich die Tarifparteien nicht innerhalb der vorgesehenen Verhandlungsrunden einigen, folgen gegebenenfalls weitere Verhandlungstermine, um eine Einigung herbeizuführen. Auch die Schlichtung ist eine Option – vorausgesetzt, beide Tarifparteien stimmen dieser zu.
Nicht zuletzt können die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert erklären und ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Grundsätzlich können auch die Arbeitgebenden die Verhandlungen für gescheitert erklären.
Wie wird das Tarifergebnis auf die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen übertragen?
Die zuständigen Landesparlamente können das Tarifergebnis mit einem Besoldungsgesetz auf die Landes- und Kommunalbeamt*innen sowie die entsprechenden Versorgungsempfänger*innen übertragen. Das ist kein Automatismus, der Gesetzgeber ist nicht dazu verpflichtet. Er ist nur verpflichtet, die Besoldung an die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse anzupassen, wozu auch – aber nicht ausschließlich – der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gehört.
Übertragen können die Landesparlamente nur, was rechtlich zulässig und möglich ist. Dies nennt man systemgerecht.
Nicht alle Vereinbarungen lassen sich vom Tarifrecht direkt ins Beamtenrecht übertragen. Problematisch sind unter anderem Sockelbeträge oder Mindestbezüge, da es im Beamtenrecht ein sogenanntes Abstandsgebot gibt. Das bedeutet: Zwischen den Besoldungsgruppen muss, was die Höhe der Besoldung betrifft, ein bestimmter Abstand bestehen. Die Besoldungsgruppen spiegeln nämlich den Leistungsgrundsatz wider, den es einzuhalten gilt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Sockelbeträge in lineare Anpassungen umzurechnen und damit auf das Beamtenrecht zu übertragen. Damit würde auch dieser Teil der Vereinbarung des Tarifvertrags für Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen in den Ländern und Kommunen wirksam.
Aus gewerkschaftlicher Sicht muss die systemgerechte Übertragung zeitgleich erfolgen – heißt: Wenn die Tarifbeschäftigten zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Geld bekommen, soll dies auch für die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen gelten.
Warum gilt der TV-L nicht für Hessen?
Hessen ist 2004 auf der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten, weil die damalige hessische Landesregierung den Kurs der anderen Bundesländer nicht mittragen und günstigere Abschlüsse erreichen wollte. Letzteres konnten die Gewerkschaften verhindern.
Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H).
Redaktion: cdi