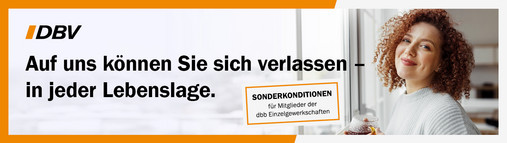-
 JobkompassAnnina ist Hebamme und arbeitet in Frankfurt am Main. Foto: Privat
JobkompassAnnina ist Hebamme und arbeitet in Frankfurt am Main. Foto: Privat
Wie wird man Hebamme? Viel mehr als Kreißsaal
Hebammen begleiten, was Eltern in der Erinnerung häufig als einen der schönsten Momente im Leben beschreiben. Annina ist eine von ihnen.
Zum FAQ: Wie wird man Hebamme?
An der Wand eine Lichterkette, warmes Licht im Kreißsaal. Die Mutter hat es sich gewünscht, ihr Kind im Schein der kleinen Lampen zu gebären. „Ich finde es stark, wenn Frauen den Moment gestalten und mit klaren Vorstellungen in die Klinik kommen“, sagt Annina. „Wir versuchen, alles umzusetzen, was ihnen guttut.“
Wichtige Anker bei der Geburt sind die Väter. Meist sind sie es, die bei der ersten Untersuchung des Babys, Gewicht und Körpergröße notieren. Ein erstes Foto, und schon geht die frohe Botschaft vom Nachwuchs per Messenger an Familie, Verwandte und Freunde.
Annina Scheiner ist Hebamme im Bürgerhospital in Frankfurt am Main, wo im Jahresdurchschnitt mehr als 4.300 Kinder zur Welt kommen, täglich etwa zwischen zehn und 15. „Jede Geburt ist für mich etwas ganz Besonderes“, sagt die 33-Jährige. Routine gebe es für sie nur mit Blick auf Prozesse, die wichtig seien, um das Pensum zu schaffen und in Notfällen das Richtige zu tun. „Mein Anspruch ist, jede Frau als Individuum wahrzunehmen. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen ich Gänsehaut bekomme“ – zum Beispiel neulich bei einer Wassergeburt. Die Boxen im Kreißsaal spielten klassische Musik, so hatten es sich die Eltern gewünscht. „Es war so schön, ich hatte kurz Tränen in den Augen.“
Klare Empfehlung: „Macht ein Praktikum!“
Den Wunsch, Hebamme zu werden, hegt Annina, die gebürtig aus dem Hintertaunus kommt, schon als Jugendliche. „Meine Eltern haben mich zu einer Hebamme im Ort geschickt und meinten, ich solle mal mit ihr sprechen“, erinnert sie sich. Gesagt, getan. Prompt absolviert die damalige Schülerin ein zweiwöchiges Praktikum. Sie ist bei Hausbesuchen dabei, bekommt Einblicke in die Geburtsvorbereitung und Wochenbett-Begleitung. Das sogenannte Wochenbett endet sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Es ist die Zeit, in der sich Eltern und Kind kennenlernen. Dabei begleiten Hebammen die Familien und stellen zum Beispiel sicher, dass sich die Gebärmutter korrekt zurückbildet und das Stillen klappt. Außerdem beraten sie bei allen aufkommenden Fragen und Herausforderungen.
„Ich fand es unfassbar faszinierend, die Momente mit den Familien zu teilen“, sagt Annina. „Das hat sich bis heute nicht geändert.“ Zu einem Praktikum würde sie allen raten, die mit den Gedanken spielen, in den Beruf einzusteigen. So lässt sich schnell feststellen, ob die eigenen Vorstellungen mit der Realität übereinstimmen.
Der Job kann psychisch und physisch sehr fordernd sein. Aber er ist eben auch maximal erfüllend!
Annina
Nach dem Fachabitur folgt eine kurze Phase der Ernüchterung. Die Ausbildungsplätze sind rar. Annina geht in dieser Runde leer aus. Sie überlegt, wie sie die Zeit bis zum nächsten Ausbildungsstart sinnvoll nutzen kann, und entscheidet sich bewusst für ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Privat hatte ich keine Berührungspunkte mit Menschen, die mit Einschränkungen leben“, erzählt sie. „Das wollte ich ändern, weil es im Hebammenberuf durchaus ein Thema ist.“ Etwa in Zusammenhang mit Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom.
Kreißsaal oder Hausbesuche?
Im zweiten Anlauf klappt es mit dem Ausbildungsplatz. Annina startet an der Universitätsklinik in Gießen durch. 2014 macht sie ihr Examen, ihre erste Stelle als staatlich geprüfte Hebamme tritt sie im Frankfurter Bürgerhospital an. Dort hat sie vor allem mit den Geburten selbst zu tun. Die erste ist ihr noch in guter Erinnerung: „Das war am 4. April 2014! Und die erste Zwillingsgeburt war am 4. April 2015!“
Der Job ist viel mehr als Kreißsaal. Um die volle Bandbreite auszuschöpfen und neue Erfahrungen zu sammeln, entscheidet Annina sich, parallel einige Jahre selbstständig zu arbeiten. Im Prinzip können Frauen die Leistungen einer Hebamme in Anspruch nehmen, sobald ein positiver Schwangerschaftstest vorliegt. „Was passiert mit dem Körper?“ Oder: „Wie bereite ich mich auf die Geburt vor?“ Das sind Fragen, auf die Hebammen Antworten liefern. „Spannend ist, dass in den letzten Jahren auch die emotionale Vorbereitung auf das Elternwerden stärker in den Fokus rückt.“
Auch Männer sind Hebammen
Leider kommt es auch zu Situationen, in denen Hebammen vor allem als emotionale Stütze gefordert sind. Nicht jede Schwangerschaft verläuft positiv. Bei Schicksalsschlägen fallen Betroffene häufig in ein Loch. Träume platzen, Wünsche und Erwartungen lösen sich in Luft auf. Hebammen bauen die Frauen wieder auf. Auch im Kreißsaal läuft es nicht immer reibungslos. Es kann trotz hoher Standards in der Vorsorge zu Komplikationen kommen.
Annina ist es wichtig, angehende Hebammen auch für diese Seiten des Berufes zu sensibilisieren. Seit 2018 ist sie Praxisanleiterin und bildet selbst Nachwuchskräfte aus. 2020 hat die Regierung die Ausbildung akademisiert. Um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben, hat die Hebamme aus Frankfurt an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln berufsbegleitend ein Studium der Hebammenkunde draufgesattelt. Dieses richtet sich an alle, die bereits Berufserfahrung mitbringen. Übrigens: Seit der Akademisierung des Berufs gilt die Bezeichnung „Hebamme“ auch für Männer. Die Bezeichnung „Entbindungspfleger“ ist mittlerweile überholt.
Welche Charaktereigenschaften angehende Hebammen mitbringen sollten? In schwierigen Situationen einen klaren Kopf bewahren. Empathisch sein. Empowern können. Ein großes Herz haben – all das ist von Bedeutung, unterstreicht die Hebamme. Wichtig ist auch, sich auf Schichtdienste einzustellen. „Der Job kann psychisch und physisch sehr fordernd sein. Aber er ist eben auch maximal erfüllend!“
Mehr entdecken: FAQ für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst
Das macht Annina, die parallel zur Selbstständigkeit im Bürgerhospital arbeitet, an bestimmen Momenten fest, die für sie immer besonders bleiben werden. Der Moment, in dem der Säugling instinktiv nach der Brust der Mutter sucht, etwa 20 Minuten nach der Geburt – „das ist ganz herrlich zu beobachten“. Der Moment, wenn Eltern das Geschlecht des Kindes nach der Geburt erfahren, sofern sie es vorher nicht wussten – „das hat immer etwas Magisches“. Und an dem Glücksmoment, den die Augen der Eltern spiegeln, wenn sie die Klinik zusammen mit ihrem neuen Familienmitglied verlassen.
Text: Christoph Dierking
FAQ: Wie wird man Hebamme?
Welche Voraussetzungen muss ich für das Hebammenstudium mitbringen?
Erforderlich ist das Fachabitur beziehungsweise Abitur, alternativ eine abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf.
Wer sich um einen Studienplatz bewirbt, muss außerdem eine Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung vorlegen sowie ein polizeiliches Führungszeugnis.
Wie lange dauert das Hebammenstudium?
Die Studienzeit umfasst in der Regel sieben bis acht Semester.
Wo findet das duale Studium statt?
Das theoretische Studium findet an Hochschulen statt, der Praxisanteil in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, in denen Hebammen arbeiten.
Was sind zentrale Ausbildungsinhalte?
Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbett-Begleitung sowie Gynäkologie und Kinderheilkunde. Hinzu kommen wissenschaftliches, evidenzbasiertes Arbeiten, Ethik und Kommunikationsstrategien.
Was verdiene ich, wenn ich das Hebammenstudium abgeschlossen habe?
Angestellte Hebammen steigen mit der Entgeltgruppe P10 in den Beruf ein (TVöD, P-Tabelle).
Auch für Dualstudierende Hebammen gilt ein Tarifvertrag (TVHöD).
Die aktuellen Entgelttabellen veröffentlicht der dbb beamtenbund und tarifunion.
Selbstständige Hebammen müssen erbrachte Leistungen mit den Krankenkassen abrechnen, die für alle Leistungen einen bestimmten Bruttobetrag zahlen. Das Einkommen kann sich deutlich von dem der tarifbeschäftigten Hebammen unterscheiden.
Was sind mögliche Karriereperspektiven?
Hebammen arbeiten freiberuflich und im Angestelltenverhältnis, und das an ganz unterschiedlichen Orten: in Krankenhäusern, in gynäkologischen Praxen, in Geburtshäusern. Es besteht die Möglichkeit, je nach Interesse eigene Schwerpunkte zu legen, zum Beispiel auf die Geburtsvorbereitung, die Geburt selbst oder die Wochenbett-Begleitung.
Wer möchte, kann Kurse leiten, die sich mit einem bestimmten Aspekt der Schwangerschaft beschäftigen, Hebammensprechstunden anbieten oder mit Behörden zusammenarbeiten und werdenden Eltern aus sozial benachteiligten Familien zur Seite stehen.
Weitere Optionen sind Tätigkeiten in der Ausbildung, Lehre und Forschung: entweder in einem Krankenhaus als Praxisanleiter*in oder als Dozent*in an einer Hochschule.
Wo finde ich weitere Informationen, wenn ich mich für das Hebammenstudium interessiere?
Allgemeine Informationen stellen unter anderem das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundesarbeitsagentur für Arbeit zur Verfügung.
Spezifische Informationen über Studiengänge bieten alle Hochschulen, die ein Hebammenstudium anbieten, sowie Einrichtungen, in denen der praktische Teil des Studiums erfolgt, etwa die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln und das Bürgerhospital in Frankfurt am Main (exemplarisch).