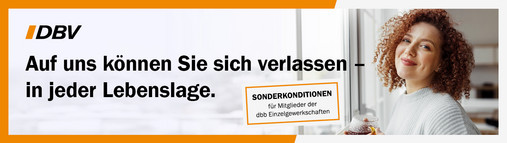-
 JobkompassAls Techniker für Ländliche Entwicklung kommt Andres viel herum. Foto: Privat
JobkompassAls Techniker für Ländliche Entwicklung kommt Andres viel herum. Foto: Privat
Techniker*in für Ländliche Entwicklung Im Einsatz für die Attraktivität der Region
Grundstücksgrenzen neu gestalten, mit Eigentümern verhandeln, den ländlichen Raum fit für die Zukunft machen: Andres ist Techniker für Ländliche Entwicklung. Seine Arbeit beginnt, wenn es etwas zu verbessern gibt.
Zum FAQ: Techniker*in für Ländliche Entwicklung
Überall im ländlichen Raum finden sich Spuren der Vergangenheit. Ein prominentes Beispiel sind die Folgen der Realteilung, die lange gängige Praxis war: Dabei wurde der Grundbesitz eines Landwirts nach seinem Tod gleichberechtigt unter seinen Kindern aufgeteilt. Hatte er fünf Kinder, gab es fortan fünf neue Grundbesitzer und damit fünf neue Grundstücke. Durch die Zersplitterung verringerte sich die nutzbare Fläche, was die Landwirtschaft ineffizienter machte. Noch heute müssen Landwirte umliegende Grundstücke pachten, um höhere Erträge zu erzielen.
Gescheite Grundstückszuschnitte schaffen
Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit: eine sogenannte Flurneuordnung, die zersplittertes Land wieder zusammenführt. Diese setzt die rechtliche Klärung von Eigentumsverhältnissen voraus und geht in der Regel mit dem Rückbau von Grenzstreifen und Zufahrtswegen einher, die dann überflüssig werden. „Am Ende bekommen die Leute ein gescheites Grundstück, das sich optimal nutzen lässt“, sagt Andres Greser. Er ist Techniker für Ländliche Entwicklung und gehört zu denen, die an besagtem Verfahren mitwirken. „Oft ergreifen die Gemeinden selbst die Initiative. Und wir stehen ihnen mit unserer Expertise zur Seite.“
„Wir“ – das sind in diesem Fall Andres und seine Kolleginnen und Kollegen, die beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken in Würzburg arbeiten. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich über den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken. Nicht nur in Flurneuordnungsverfahren gibt es viel zu tun: Die Behörde ist an zahlreichen Projekten beteiligt, die Land- und Dorfentwicklung betreffen. Hierfür können die Gemeinden Fördergelder abrufen – das Amt informiert über die Möglichkeiten. Konkret kann es dabei um den Verlauf von Straßen, Wegen und Gewässern gehen, aber auch um Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasser- und Erosionsschutz. In Bayern gibt es in jedem der sieben Regierungsbezirke ein Amt für Ländliche Entwicklung. In anderen Bundesländern ist das Fachgebiet mitunter in andere Behörden integriert, beispielsweise in Landratsämter.
Ich bin in ganz Unterfranken unterwegs und habe die Region völlig neu kennengelernt.
Andres über einen Vorzug seines Berufs
Wie Andres in den Job gekommen ist? „Ein Familienmitglied war einmal an einem Verfahren beteiligt, bei dem es um eine Waldneuordnung ging“, erzählt der 24-Jährige. „Das war sozusagen der erste Berührungspunkt.“ Als Schüler macht der gebürtige Marktheidenfelder (Landkreis Main-Spessart) ein Praktikum beim Vermessungsamt (ADBV), die Tätigkeit macht ihm Spaß – doch am Ende entscheidet er sich nach der Mittelschule dafür, Landschaften statt Bauwerke zu vermessen und startet in die Ausbildung zum Techniker für Ländliche Entwicklung. Verfahrenstheorie, Vermessungskunde, aber vor allem der Umgang mit Messtechnik stehen auf dem Lehrplan. Auf die zweieinhalbjährige Berufsausbildung folgt ein einjähriger Vorbereitungsdienst, der mit einer Staatsprüfung endet.
Mal im Büro, mal im Außendienst
Techniker*innen für Ländliche Entwicklung kommen viel herum. „Ich bin in ganz Unterfranken unterwegs und habe die Region völlig neu kennengelernt“, erzählt der Beamte. Das mache den Job abwechslungsreich, die Mischung aus Büro und Natur ist für ihn ein klarer Pluspunkt. Was er besonders genießt: das Entdecken von Dörfern und Landschaften, die zwar weniger bekannt, aber doch sehenswert sind. Außerdem hat Andres viel mit Menschen zu tun. Zum Beispiel bespricht und verhandelt er Neugestaltungen von Grundstücken mit den Beteiligten, darunter Eigentümer und Gemeinden. Auch Wertermittlungen sind Teil des Verfahrens. Wenn alle Akteure, zum Beispiel andere Behörden, grünes Licht geben, erfolgt die Neugestaltung und die Bagger können rollen.
Mehr entdecken: FAQ für junge Beamtinnen und Beamte
Für Andres steht vor Ort meist die Vermessung im Fokus. Ziel ist es, dass am Ende eine aktualisierte Karte vorliegt, die neue Eigentums- und Besitzbesitzverhältnisse und gegebenenfalls Neugestaltungen widerspiegelt. Letzteres kann beispielsweise renaturierte Gewässer betreffen, die nun nicht mehr schnurgerade verlaufen, sondern natürlich durch die Landschaft mäandrieren. Darüber hinaus müssen vereinbarte Neueinteilungen in die Natur übertragen werden. Kurzum: Es geht um die Pflege der Bodenordnung. „Man muss sehr genau arbeiten und in der Lage sein zu improvisieren“, berichtet der Beamte.
Nach dem Außendienst folgt der Innendienst: Im Büro überträgt der Techniker für Ländliche Entwicklung die gemessenen Daten ins System und erstellt auf der Grundlange aktualisiertes Kartenmaterial. Dieses speichert er in einer elektronischen Akte ab. Ein erklärtes Ziel der Behörde ist es, weitgehend papierlos zu arbeiten.
Was Andres an seinem Job besonders erfüllt? „Auch wenn die Verfahren lange dauern, am Ende steht immer eine attraktivere Landschaft, die sich besser nutzen lässt und nachhaltiger aufgestellt ist. Davon profitieren alle.“
Text: Christoph Dierking
FAQ: Techniker*in für Ländliche Entwicklung
Welche Voraussetzungen muss ich für die Ausbildung mitbringen?
Erforderlich ist mindestens ein Qualifizierender Mittelschulabschluss (Quali).
Wie lange dauert die Ausbildung?
In Bayern dauert die Berufsausbildung 2,5 Jahre, darauf folgt ein einjähriger Vorbereitungsdienst. In anderen Bundesländern kann die Ausbildungsdauer abweichen.
Was sind zentrale Ausbildungsinhalte?
Auf dem Lehrplan stehen Rechtsgrundlagen, Verfahrenstheorie und vermessungstechnisches Rechnen. Hinzu kommen Vermessungskunde, Geovisualisierung sowie der praktische Umgang mit Messtechnik und Software.
Wo findet die Ausbildung statt?
Die theoretische Ausbildung findet in Bayern in der zuständigen Berufsschule in Ansbach statt, die praktische Ausbildung vor Ort in den jeweiligen Ämtern für Ländliche Entwicklung.
Was verdient man als Techniker*in für Ländliche Entwicklung?
Mit erfolgreicher Ausbildung und nach bestandener Staatsprüfung steigen die Absolventinnen und Absolventen in die Besoldungsgruppe A7 ein.
Die aktuellen Besoldungstabellen veröffentlicht der dbb beamtenbund und tarifunion.
Welche Karriereoptionen gibt es?
Wer Abitur beziehungsweise Fachabitur hat, kann ein Studium draufsatteln und beispielsweise als Vermessungsingenieur*in (Projektleiter) aus den mittleren in den gehobenen Dienst aufsteigen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Über die Ausbildung informieren die auszubildenden Behörden auf ihren Karriereportalen, hier exemplarisch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.
Als zuständige Fachgewerkschaft steht der Verband Bayerischer Beamter Ländliche Entwicklung (VBBLE) als Ansprechpartner zur Verfügung.