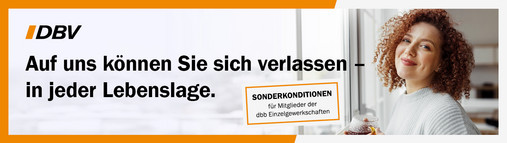-
 JobkompassSetzt sich dafür ein, dass es Kindern, Jugendlichen und Familien gut geht: Jan ist Sozialarbeiter in Hamburg. Foto: Privat
JobkompassSetzt sich dafür ein, dass es Kindern, Jugendlichen und Familien gut geht: Jan ist Sozialarbeiter in Hamburg. Foto: Privat
Ambulante Kinder- und Jugendhilfe Wenn das Ziel ist, sich überflüssig zu machen
Jan ist Sozialarbeiter, staatlich anerkannter Sozialpädagoge und hat in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Heute ist er beim Jugendamt. Im Job ist er teils mit schweren Schicksalen konfrontiert.
Zum FAQ: Wie wird man Sozialarbeiter*in?
Eine verwahrloste Wohnung, irgendwo in Hamburg: Die Familie bietet Jan einen Platz auf dem Sofa an, es ist vollkommen verdreckt. Er nimmt seinen Block, legt ihn diskret aufs Sofa, dann lässt er sich nieder. „Man kann ja nicht einfach stehenbleiben und von oben herab mit den Leuten sprechen, das wäre respektlos. Augenhöhe ist wichtig.“
Sich in solchen Situationen diskret auf einen Block zu setzen – dieses Vorgehen hat eine Dozentin der Hochschule Coburg beschrieben, wo Jan Soziale Arbeit studiert hat. Sozialarbeitende haben zuweilen mit Menschen aller Schichten der Gesellschaft zu tun. Mit suchtkranken Personen, mit verwahrlosten Familien, mit wohlhabenden Menschen – „man muss sich auf alle Eventualitäten einstellen“, sagt der 31-Jährige, der nach dem Studium als Fachkraft in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe in den Beruf startet. Zum Zeitpunkt des Interviews mit #staatklar arbeitet er seit einem Monat beim Jugendamt in Hamburg, genau: im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Dieser ist die zentrale Anlaufstelle beim Jugendamt für Familien in Notlagen.
Der Job besteht darin, sich in Menschen und Familiensysteme hineinzuversetzen und bestmöglich versuchen zu verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun.
Jan
Erst Metalltechnik, dann Soziale Arbeit
Nach dem Hauptschulabschluss macht Jan zunächst eine Ausbildung in der Fahrradtechnik und erarbeitet sich damit den Realschulabschluss; anschließend den Fachoberschulabschluss Metalltechnik und damit die Berechtigung, an Hochschulen zu studieren. „Wichtig war mir, vor dem Studium noch einmal ins Ausland zu gehen“, erzählt der gebürtige Oldenburger.
Über das Erasmus-Plus-Programm findet er einen Träger in Tschechien und unterstützt in Náchod, nahe der polnischen Grenze, den Deutschunterricht an einer Schule. Obwohl ihm die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen schon damals große Freude bereitet, entscheidet er sich nach der Zeit in Tschechien zunächst für ein Studium der Offshore-Anlagentechnik in Kiel. „Für den Moment fühlte sich das richtig an, weil ich damit an meine Ausbildung anknüpfen konnte“ – doch nach zwei Semestern steht fest: Es ist doch nicht das Richtige. „Dann habe ich alles auf die Soziale Arbeit gesetzt.“
Auf welche Charaktereigenschaften es in der Sozialen Arbeit ankommt? Ganz oben steht Empathie. „Der Job besteht darin, sich in Menschen und Familiensysteme hineinzuversetzen und bestmöglich versuchen zu verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun“, erklärt Jan. Es sei wichtig, die individuellen Bedürfnisse auf dem Schirm zu haben. „Nur dann kann man Strategien entwickeln, um den Menschen Handlungsräume aufzuzeigen, in denen sie Herausforderungen gemeinsam oder eigenständig lösen können.“
Ebenfalls von Bedeutung: Belastbarkeit. Je nach Einsatzort sind die Arbeitszeiten unregelmäßig. Es gehört dazu, mit teils schweren Krisen zurechtzukommen. Diese Lektion hat Jan in einer betreuten Wohngruppe gelernt, in der er während des Studiums einen Praxiseinsatz hatte: „Grundsätzlich sind dort liebe Menschen“ – aber sie seien eben dort, weil sie unschöne Dinge erlebt haben, manchmal auch traumatisiert sind. „Man muss diese Krisen gemeinsam mit den Betroffenen durchleben können.“
Und nicht zuletzt kommt es auf die Fähigkeit an, auf sich selbst gut aufzupassen und einen Ausgleich zum Job zu haben. „Ich kann andere nur dann unterstützen, wenn es mir selbst gut geht“, unterstreicht der Sozialarbeiter. „Wenn ich Feierabend und Urlaub habe, dürfen meine Gedanken nicht ständig um Familie XY kreisen.“
Erst freier Träger, dann Jugendamt
Nach dem Studium startet Jan in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe bei einem freien Träger in Hamburg durch. Als Sozialarbeiter arbeitet er unter anderem in den Rollen des Erziehungsbeistandes und in der sozialpädagogischen Familienhilfe, in denen er jeweils mit Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern kooperiert. Er begleitet Minderjährige, die ihre Eltern – dafür gibt es verschiedenste Gründe – nur in Begleitung einer sozialpädagogischen Fachkraft sehen dürfen. Und er besetzt Bereitschaftsdienste, bei denen in manchen Fällen lediglich ein paar Telefonate anfallen. Im Extremfall kann die Schicht aber auch in die Begleitung einer Inobhutnahme münden.
„Es war insgesamt eine nicht selten fordernde, aber auch sehr spannende und vor allem lehrreiche Zeit“, berichtet Jan. Zum Jugendamt ist er gewechselt, weil es schon immer sein großes Ziel war, die Kinder- und Jugendhilfe aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. „Persönlich glaube ich, dass es gut ist, bei freien Trägern Berufserfahrung zu sammeln, bevor man ins Jugendamt wechselt“ – denn dort hätten die Beschäftigten schließlich das Wächteramt inne und müssten das Kindeswohl garantieren können. „Das ist noch einmal eine andere Dimension an Verantwortung.“
Mehr entdecken: FAQ für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst
Es kann immer etwas Unerwartetes passieren, es wird nie langweilig!
Jan
Warum Jan den Job, trotz aller Herausforderungen, gerne macht? „Da spielt eine Mischung aus verschiedenen Dingen eine Rolle“, sagt er. Unter anderem seine intrinsische Motivation, sich dafür einzusetzen, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht. Hinzu komme fachliche Neugier; die Zahl der Themen, Lebensumstände und Schicksale, mit denen er zu tun hat, sei enorm. Routine gebe es kaum – wenn, dann nur mit Blick auf bestimmte Arbeitsabläufe. Fazit: „Es kann immer etwas Unerwartetes passieren, es wird nie langweilig!“
Und wann er mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause geht? „Ziel in der Sozialen Arbeit ist es, sich überflüssig zu machen. Entsprechend bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, wenn bei den Familien und oder Personen alles gut ist und ich nicht mehr gebraucht werde.“
Text: Christoph Dierking
FAQ: Wie wird man Sozialarbeiter*in?
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich Soziale Arbeit studieren möchte?
Für den Studiengang „Soziale Arbeit“ ist die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erforderlich. Einige Hochschulen lassen unter bestimmten Voraussetzungen auch Bewerber*innen zu, die eine fachlich passende Berufsausbildung gemacht haben.
Wie lange dauert das Studium?
Die Regelstudienzeit beträgt sechs bis sieben Semester (Bachelor). Abhängig vom Bundesland und der Hochschule folgt darauf eine Praxisphase für die staatliche Anerkennung, das sogenannte Anerkennungsjahr. In vielen Studiengängen ist die Praxisphase bereits in die Regelstudienzeit integriert.
Was sind zentrale Studieninhalte?
Im Fokus des Studiums stehen fachliche und methodische Kompetenzen der Sozialarbeit. Dazu gehören viele interdisziplinäre Grundlagen wie Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Case Management, Soziologie und Rechtswissenschaften. Meistens beinhaltet das Studium auch einen Forschungsanteil. Darüber hinaus erlernen die Studierenden Gesprächsführung und Beratungstechniken.
Wo findet die Ausbildung statt?
Wer Soziale Arbeit studieren möchte, hat die Wahl zwischen Fachhochschulen, Universitäten und Berufsakademien in ganz Deutschland. In welchem Bereich und bei welchem Träger die Studierenden ihre Praxisphasen beziehungsweise das Anerkennungsjahr absolvieren, können sie in der Regel selbst entscheiden.
Was verdient man als Sozialarbeiter*in?
Es ist schwierig, eine allgemeine Vergütung zu benennen, da diese stark vom Träger beziehungsweise dem Arbeitgebenden abhängt. Orientierung bietet der Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TvÖD SuE). Aus Sicht des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit (DBSH) sollten Sozialarbeitende nicht weniger erhalten, als dort festgelegt ist. Die Eingruppierung richtet sich nach der Tätigkeit.
Die aktuellen Entgelttabellen veröffentlicht der dbb beamtenbund und tarifunion.
Welche Karrierechancen bieten sich mir nach dem Studium der Sozialen Arbeit?
Beratung, Bildung, Sozialmanagement – Sozialarbeitenden stehen zahlreiche Beschäftigungsfelder offen. Wer einen Master absolviert, kann promovieren und in die Forschung gehen. Außerdem besetzen viele soziale Einrichtungen Leitungspositionen mit Sozialarbeiter*innen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) informiert umfassend zu Studium, staatlicher Anerkennung und Praxissemestern. Weitere Informationen gibt es auch auf Instagram.