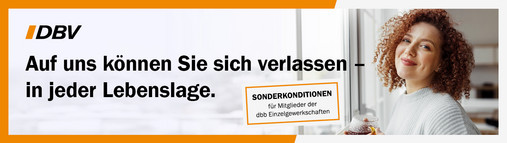-
 InterviewWelche Konsequenzen sollte die Politik aus der Trendstudie Jugend in Deutschland 2025 ziehen? Co-Autor Dr. Kilian Hampel ordnet im Interview mit #staatklar die Erkenntnisse ein. Foto: Marc-Steffen Unger
InterviewWelche Konsequenzen sollte die Politik aus der Trendstudie Jugend in Deutschland 2025 ziehen? Co-Autor Dr. Kilian Hampel ordnet im Interview mit #staatklar die Erkenntnisse ein. Foto: Marc-Steffen Unger
Trendstudie Jugend in Deutschland 2025 Was aus den Ergebnissen folgen muss
Stressbewältigung, Medienkompetenz, Demokratieförderung – in diesen Punkten muss die Politik nachbessern, sagt Dr. Kilian Hampel, Co-Autor der Trendstudie Jugend in Deutschland. Und es braucht einen Mentalitätswechsel.
Zunächst die guten Nachrichten: „Gefreut hat uns, dass die jungen Leute trotz Krisen, Stressbelastung und unklarer Perspektiven positiv in die Zukunft blicken“, sagt Dr. Kilian Hampel, der neben Simon Schnetzer und Prof. Klaus Hurrelmann zum Autorenteam der Trendstudie gehört, im Interview mit #staatklar. Mehr als die Hälfte der Befragten im Alter von 14 bis 29 gab an, davon auszugehen, dass sich die eigene Lebenssituation in den nächsten zwei Jahren verbessert – deutlich mehr als in den älteren Generationen.
Mehr entdecken: Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 – zentrale Ergebnisse
„Das Phänomen ist nicht neu, ältere Menschen sind grundsätzlich pessimistischer, zum Teil aus Selbstschutz“, erklärt der Wissenschaftler. Dann sei die Fallhöhe geringer, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Diese Einstellung habe bereits die vergangene Trendstudie mit Generationenvergleich aus dem Jahr 2023 gezeigt.
Die weniger guten Nachrichten, jenseits der optimistischen Gesinnung: Viele junge Menschen leiden unter Stress, außerdem schwindet das Vertrauen in die Demokratie und die Handlungsfähigkeit der Regierung. Und nicht zuletzt gibt es Vorurteile, die sich hartnäckig halten.
#staatklar: Herr Hampel, die Überzeugung, junge Menschen seien faul und würden nicht arbeiten wollen, ist weit verbreitet. Lässt sich das durch die Studienergebnisse belegen?
Kilian Hampel: Nein, auf keinen Fall, ganz im Gegenteil! Was das betrifft, muss ein Mentalitätswechsel stattfinden, weil es schlicht und ergreifend nicht stimmt. Wir haben die jungen Menschen gefragt, wie sie ihre Motivation am Arbeitsplatz einschätzen. 81 Prozent sagten, dass sie für gute Leistungen ihr Bestes geben – das zeigt ganz klar: Es mangelt nicht an Leistungsbereitschaft. Diese Einschätzung überschneidet sich mit der Einschätzung von Führungskräften, das wissen wir aus der Organisationspsychologie.
Das Problem ist, dass Faulheit oft mit dem Wunsch nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance gleichgesetzt wird.
Dr. Kilian Hampel
Im Übrigen gaben ebenfalls 81 Prozent der Befragten an, in Vollzeit zu arbeiten. Davon würden 54 Prozent in Zukunft gleichviel arbeiten, zehn Prozent sogar noch mehr. Von fehlender Leistungsbereitschaft kann also keine Rede sein.
Das Problem ist, dass Faulheit oft mit dem Wunsch nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance gleichgesetzt wird. Diesen Wunsch hegt allerdings nicht nur die junge Generation, sondern auch die ältere. Alle wollen nach getaner Arbeit aufatmen können. Das ist nicht negativ, sondern zeugt von Verantwortung gegenüber der eigenen Gesundheit.
Was müssen Wirtschaft und Politik unternehmen, damit junge Menschen ihre Leistungsbereitschaft optimal entfalten können?
Zunächst ist es falsch zu sagen, dass sich alle jetzt gefälligst mal anstrengen sollten. Denn das passiert bereits. Noch nie wurden so viele Überstunden geleistet. Davon sind zahlreiche unbezahlt, aber das nur am Rande. Das sollte man wertschätzen. Es ist doch vollkommen klar, dass sich Wohlstand nur durch Arbeit wahren lässt.
Ganz konkret muss die Politik die Bedingungen schaffen, damit junge Familien Arbeits- und Privatleben miteinander vereinbaren können. Der Staat muss mehr in Kita-Plätze investieren. Entscheidend ist auch, dass er eine nachhaltige Antwort für die Finanzierung der Zeit nach dem aktiven Berufsleben findet – denn auch das ist ein Thema, das junge Menschen umtreibt. Die Sorge, dass es trotz Vollzeitjob am Ende möglicherweise nicht für ein ausreichendes Alterseinkommen reicht, schmälert die Leistungsbereitschaft.
Am Arbeitsplatz selbst müssen die Atmosphäre und die Bedingungen stimmen: Das umfasst die Begegnung auf Augenhöhe, unterstützende Teams und Führungskräfte, Arbeitgebende, die verschiedenen Lebensentwürfen gerecht werden, spannende Perspektiven und Mitsprache.
49 Prozent der Befragten im Alter zwischen 14 und 29 haben angegeben, dass sie unter Stress leiden. Was ist erforderlich, um die psychische Belastung zu reduzieren?
Wir brauchen Räume, in denen wir das Thema in den Mittelpunkt stellen können. In der Schule ist mehr Sozialarbeit gefragt, bestehende Akteure müssen hier sichtbarer und wirksamer gemacht werden. In Ausbildung und Job müssen wir für eine Kultur der Offenheit arbeiten, in der niemand stigmatisiert wird, wenn die Belastung als zu groß empfunden wird. Klar ist auch: Die Wartezeiten für Therapieplätze sind aktuell zu lang. Besonders fatal ist in diesem Zusammenhang, dass die öffentliche Hand die Finanzierung von Beratungsangeboten wie die „Nummer gegen Kummer“ eingestellt hat. Da brauchen wir eine Kehrtwende.
Mehr entdecken: Mobbing, Streit, Suizidgedanken – so hilft die Nummer gegen Kummer
Ein weiteres Ergebnis der Trendstudie ist, dass zwischen Stressempfinden und Mediennutzung, insbesondere der Nutzung Sozialer Medien, ein Zusammenhang besteht. Stressbewältigung muss mit Medienkompetenz einhergehen. Letztere gehört auf den Lehrplan!
Ein fairer Generationenvertrag beantwortet die Frage, wie wir als Gesellschaft künftig die Altersversorgung fair gestalten.
Dr. Kilian Hampel
Auch die Demokratie steht unter Stress, bei der Jugend sinken die Zustimmungswerte. Zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen nehmen wahr, dass Deutschland politisch nach rechts driftet.
Ja, das ist besorgniserregend. Die Länder müssen für mehr Demokratiebildung in den Schulen sorgen – und zwar so, dass Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erfahren. Demokratie lernt man am besten, wenn man sie erlebt. Das geht nicht ohne finanzielle Mittel, die der Staat zur Verfügung stellen muss.
Alarmierend ist: Laut unserer Studie vertrauen nur zwölf Prozent der 14- bis 29-Jährigen darauf, dass die Regierung das Richtige tut. Dieser Wert belegt eindrücklich, dass die Politik die Sorgen der Menschen ernst nehmen, ihre Probleme anpacken und Verbesserungen erzielen muss, die sich im Alltag spüren lassen. Ganz entscheidend ist auch, das Gesamtpaket als Vision zu verkaufen, die alle einbezieht: Wirtschaft, Gesellschaft, Jung und Alt. So gewinnt man Vertrauen zurück.
Als Forschungsteam, das die Trendstudie herausgibt, plädieren Sie für einen Generationenvertrag, der eine solche Vision verkörpert. Was muss er beinhalten?
Ein Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass nicht bloß eine Seite zustimmt und unterschreibt. Die Jugend will auf Augenhöhe mitentscheiden. Dabei tickt sie bemerkenswert solidarisch und zeigt sich bereit, Belastungen zu schultern. Sie will überwiegend nicht, dass die ältere Generation länger arbeiten muss, höhere Rentenbeiträge zahlt oder eine niedrigere Rente bekommt.
Wir müssen vermitteln, dass die Ressourcen begrenzt sind und diese Haltung potenziell zu Konsequenzen in anderen Politikbereichen führt, etwa mit Blick auf Bildung und Klimaschutz. Ein fairer Generationenvertrag beantwortet die Frage, wie wir als Gesellschaft künftig die Altersversorgung fair gestalten, Ressourcen über die Generation fair verteilen und in zukunftsorientierten Dialogformaten – auf Augenhöhe – fair miteinander kommunizieren.
Interview: Christoph Dierking