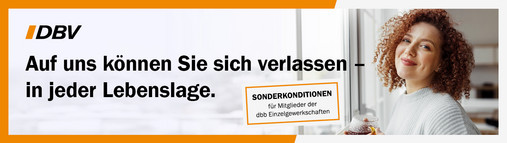-
 InterviewWas versteht man unter einer guten Führungskultur? Grundvoraussetzung ist, dass sich Führungskräfte für Menschen und damit für ihre Mitarbeitenden interessieren, sagt Stefan Wickenhäuser. Foto: Colourbox
InterviewWas versteht man unter einer guten Führungskultur? Grundvoraussetzung ist, dass sich Führungskräfte für Menschen und damit für ihre Mitarbeitenden interessieren, sagt Stefan Wickenhäuser. Foto: Colourbox
Was versteht man unter Führungskultur? Wickenhäuser: „Führung ist ein eigener Job!“
Wer fachlich gute Arbeit geleistet hat, kommt eher in Führungspositionen – warum das ein Problem sein kann, erklärt Coach Stefan Wickenhäuser im Interview.
Mitarbeitende ignorieren. Kein Feedback geben. Mikromanagement betreiben. Nicht fürs Team einstehen. Hinhaltetaktiken fahren. Kein Interesse an Mitarbeitenden und Menschen zeigen. „All das sind Beispiele für eine schlechte Führungskultur“, sagt Stefan Wickenhäuser. „Leider mache ich immer wieder die Erfahrung, dass solche Verhaltensweisen verbreitet sind.“
Wickenhäuser ist Gründer und Geschäftsführer des Start-ups Rethinking Job, das sich vor allem mit folgenden Fragen beschäftigt: Wie gelingt es, Aufgaben und Menschen bestmöglich zu matchen? Und wie lässt sich künstliche Intelligenz in der Berufswelt gewinnbringend einsetzen? Die Vision: „Jeder arbeitende Mensch soll zufrieden im Job sein dürfen.“
Aktuell ist, zumindest laut Statistik, jedoch das Gegenteil der Fall. Was die emotionale Bindung von Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz betrifft, besteht Handlungsbedarf. Der Gallup Engagement Index 2024 kommt zu dem Ergebnis, dass sich lediglich neun Prozent der Beschäftigten eng an ihren Arbeitgebenden gebunden fühlen. Zum ersten Mal überhaupt ist dieser Wert einstellig.
Führungskräfte können die emotionale Bindung maßgeblich beeinflussen. Im Interview mit #staatklar schildert Stefan Wickenhäuser, was eine gute Führungskultur auszeichnet und woran es in der Praxis oft hapert.
#staatklar: Herr Wickenhäuser, ganz grundsätzlich: Was verstehen Sie unter Personalführung?
Stefan Wickenhäuser: Führung bedeutet, sich selbst zurückzunehmen, und die Menschen, die im Team arbeiten, bestmöglich zu unterstützen. Oberstes Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, unter denen alle ihre Stärken ausleben und einen richtig guten Job machen können. Führung – und das verstehen die wenigsten – ist ein eigener Job! Im Grunde sollte es eine eigene Ausbildung zur Führungskraft geben.
Ich kenne Unternehmen, die Fehler feiern. Wenn Fehler passieren, gibt es Pizza!
Stefan Wickenhäuser
Bekommen Beschäftigte, die Führungsaufgaben übernehmen, zu wenig Unterstützung?
Nun ja, sagen wir es mal so: In meiner Wahrnehmung ist der folgende Dialog ein Klassiker. Sagt der eine: „Du, ich bin gerade befördert worden und leite jetzt ein Team!“ Darauf der andere: „Ah, gratuliere! Und fühlst du dich gut auf die neue Aufgabe vorbereitet?“ – „Absolut! Ich habe ein zweitägiges Management-Seminar besucht!“
Da würde ich mit einer großen Portion Ironie kommentieren: Wow!
Das ist beim besten Willen zu wenig. Aber in sehr vielen Fällen spiegelt es die Realität, in der wir leben. Dabei müssten Arbeitgebende eigentlich ein großes Interesse daran haben, in die Qualität der Führungskräfte zu investieren. Schlechte Führung verursacht enorme wirtschaftliche Schäden – übrigens auch in Behörden, die zwar kein Geld verdienen, aber trotzdem mit ihren Ressourcen haushalten müssen. Leider bewahrheitet sich in vielen das Peter-Prinzip.
Peter-Prinzip? Das müssen Sie erklären!
Laurence J. Peter war ein kanadisch-amerikanischer Wissenschaftler. Das nach ihm benannte Prinzip besagt: „In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.“
Schauen wir einmal auf den Vertrieb: Welcher Mitarbeiter wird am ehesten befördert?
Wahrscheinlich der, der am meisten verkauft.
Genau, so ist es. Und das beschreibt das Grundproblem in unserem Verständnis von Führung. Wer viel verkauft und gute Arbeit leistet, kommt eher in Führungspositionen. Das gilt oft auch für Mitarbeitende, die sich schon viele Jahre an Bord befinden. Aber nicht alle, die fachlich kompetent oder lange dabei sind, haben auch Führungskompetenz.
Warum gehen wir trotzdem davon aus?
Weil wir so sozialisiert sind. Wir haben den amerikanischen Traum, dass Leute vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen, verinnerlicht. Es muss immer mehr sein, man muss die Karriereleiter immer höher klettern. Dabei geht es auch anders.
Mal ein Beispiel aus meiner Praxis: 2021 habe ich 50 Führungskräfte eines Unternehmens ein dreiviertel Jahr in Vollzeit begleitet. Davon sind heute etwa 30 Prozent keine Führungskräfte mehr. Bei den Betroffenen hat eine Selbstreflexion stattgefunden und sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass sie gar nicht führen, sondern inhaltlich arbeiten wollen. Sie sind nun zufriedener – und das ist nicht zuletzt auch im Sinne des Unternehmens.
Was können wir aus diesem Beispiel lernen, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen?
In eine Führungsposition gehört, wer sich für Menschen interessiert. Jemand, der empathisch ist. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, die Stärken der Mitarbeitenden im Team zu erkennen und zu fördern.
Damit sind wir bei den Kompetenzen, die eine Führungskraft mitbringen sollte. Was ist noch wichtig?
Eine Führungskraft muss die inhaltliche Arbeit nicht zwingend gelernt haben, das ist sekundär. Klar, sie muss ein gewisses Grundverständnis mitbringen. Aber mir missfällt die verbreitete Erwartungshaltung, dass eine Führungskraft stets in der Lage sein muss, alle fachlichen Fragen zu beantworten. Dafür ist das Team zuständig. Führungskräfte, die selbst tief in der fachlichen Materie stecken, neigen zum Mikromanagement. Und das steht im Widerspruch zu einer guten Führungskultur, mit der sich alle wohlfühlen.
Noch einmal: Führungskräfte müssen Interesse an Menschen haben! Wenn mein Team Erfolge erzielt, darf ich den Erfolg nicht für mich beanspruchen. Da habe ich ganz hinten zu stehen und mein Team in den Mittelpunkt zu stellen. Jedes Teammitglied hat es geschafft, jedes Teammitglied ist für den großartigen Job verantwortlich. Mein Job bestand darin, den Rahmen dafür zu schaffen, dass alle ihre Stärken entwickeln und zielgerichtet einsetzen konnten.
Und was ist, wenn es mal nicht rundläuft?
Menschen sind keine Maschinen. Fehler passieren, weil unsere Leistung auch von der Tagesform abhängt. Das ist vollkommen normal. Ich kenne Unternehmen, die Fehler feiern. Wenn Fehler passieren, gibt es Pizza! Das schafft eine offene Fehlerkultur, in der keiner Angst haben muss, wenn mal etwas schiefläuft. Natürlich spielt auch die Reflexion darüber, wie es zu dem Fehler kommen konnte, eine entscheidende Rolle. Nur wer Fehler macht, kann lernen und besser werden.
Der Idealfall sollte sein, dass es eine Fach- und eine Führungskarriere gibt.
Stefan Wickenhäuser
Stellen wir uns vor, ein Mitarbeiter macht fünfmal denselben Fehler in Folge. Wie reagiert eine gute Führungskraft?
Wissen Sie, ich bin ein großer American-Football-Fan. Nehmen wir an, ein Spieler lässt in der alles entscheidenden Situation immer wieder den Ball fallen. Dann wäre es Aufgabe des Trainers, der Sache auf den Grund zu gehen: Braucht der Spieler eine Brille oder neue Handschuhe? Kann er nicht mit Belastungssituationen umgehen? Wäre ein Resilienz-Training hilfreich? Oder ist er letztlich auf einer anderen Position besser aufgehoben?
Auf die Arbeitswelt übertragen bedeutet das: Eine Führungskraft muss das Gespräch suchen. Fragen, ob es an der Ausstattung hapert. Oder am Wissen. Oder steckt etwas ganz anderes dahinter, etwa eine schwierige Lebensphase? Gegebenenfalls kann es auch der richtige Weg sein, dem Betroffenen eine neue Aufgabe zu geben.
Im öffentlichen Dienst ist es so, dass etwa das Laufbahnrecht ab einer gewissen Besoldungsstufe vorschreibt, Führungsaufgaben zu übernehmen. Wer Karriere machen, aber nicht führen möchte, hat keine Wahl.
Mein Plädoyer ist: Wir müssen klarer differenzieren. Der Idealfall sollte sein, dass es eine Fach- und eine Führungskarriere gibt. Heute dominiert die Vorstellung der Führungskarriere. Das macht sich nicht zuletzt auch auf dem Gehaltszettel bemerkbar. Wer führt, verdient mehr. Das gilt weitgehend als Konsens. Es braucht mehr Karriereperspektiven in der fachlichen Führung, damit alle, die keine Personalführung übernehmen möchten, ebenfalls Aufstiegschancen haben.
Dafür braucht es Mut, bestehende Strukturen infrage zu stellen und neue Wege zu beschreiten, wenn sich die alten nicht mehr bewähren. Das ist übrigens auch etwas, was eine gute Führungskraft auszeichnet.
Mehr entdecken: Wie finde ich das richtige Ehrenamt?
Bestehende Strukturen infrage stellen – das wird mit Blick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer wichtiger. Was bedeutet KI für die Führung der Zukunft?
KI hilft, Muster zu erkennen oder Prozesse zu entlasten, darin besteht das große Potenzial. Entscheidungen und Verantwortung müssen jedoch immer beim Menschen verbleiben. Gute Führung basiert auf Haltung, Vertrauen und Empathie. Führung braucht Kontext. Und der kommt von Menschen, nicht von Algorithmen.
Kurz und bündig: Was ist in Ihren Augen die ideale Führungskraft?
Menschenorientierung, das ist das Allerwichtigste! Sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Räume für Reflexion bieten. Stärken der Beschäftigten fördern und richtig einsetzen. Kein Mikromanagement betreiben. Wer all das beherzigt, wird sein Team erfolgreich führen.
Interview: Christoph Dierking