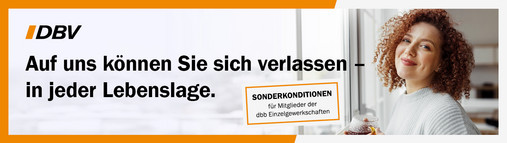-
 InterviewKerstin Sarah von Appen ist Expertin für Change-Management und berät Führungskräfte in Unternehmen und Verbänden. Foto: Hendrik Andree
InterviewKerstin Sarah von Appen ist Expertin für Change-Management und berät Führungskräfte in Unternehmen und Verbänden. Foto: Hendrik Andree
Agiles Arbeiten Stimmige Ergebnisse sind wichtiger als ein starrer Plan
Was bedeutet agiles Arbeiten? Im Interview mit #staatklar beschreibt Unternehmensberaterin Kerstin Sarah von Appen ein Konzept, das in der IT-Branche wurzelt.
Ein Unternehmen gibt eine neue Software in Auftrag, das Briefing ist mit den Entwicklern abgestimmt und sie machen sich an die Arbeit. Sie investieren viel Mühe und Zeit, machen Überstunden. Nach einigen Monaten präsentieren sie dem Kunden das Ergebnis. Alle sind stolz.
Doch prompt folgt die Ernüchterung: Der Kunde ist unzufrieden. Er fühle sich missverstanden, die Umsetzung und das Design der Software gefalle ihm nicht und im Unternehmen hätten sich neue Bedürfnisse ergeben. Beide Seiten sind frustriert.
„Solche Situationen sind in der Tat frustrierend, in der IT sind sie früher oft vorgekommen“, sagt Kerstin Sarah von Appen, Unternehmensberaterin in Berlin. Die Branche habe erkannt: Sie muss viel enger mit den Kund*innen zusammenarbeiten. Auf dieser Grundlage ist das Manifest für agile Softwareentwicklung entstanden. Es enthält folgende Leitgedanken:
- Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
- Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als das Vertragliche
- Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das strikte Befolgen eines Plans
- Ein funktionierendes Produkt ist wichtiger als umfangreiche Dokumentation
Schon längst haben diese Leitgedanken über die IT-Branche hinaus Wirkung entfaltet. Welche Chancen agiles Arbeiten für den öffentlichen Dienst bietet, darüber hat #staatklar mit Kerstin Sarah von Appen gesprochen. Sie ist Expertin für Change-Management und berät Führungskräfte in Unternehmen und Verbänden, außerdem hat sie das Buch New Work Unplugged. Die Arbeitswelt von morgen heute gestalten veröffentlicht.
#staatklar: Frau von Appen, agiles Arbeiten hat seine Wurzeln in der Softwareentwicklung: Warum sollten sich Akteure außerhalb der IT überhaupt damit beschäftigen?
Kerstin Sarah von Appen: Es macht enorm viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, um Arbeit anders zu gestalten. Agiles Arbeiten hilft, fokussiert und schnell Ergebnisse zu erzielen. Und zwar Ergebnisse, die wirklich gebraucht werden. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt alle ausschließlich auf agiles Arbeiten umstellen sollen. Es kommt immer auf den Kontext an. Die Softwarebranche gehörte zu den ersten, die merkten, dass es mit althergebrachten Vorgehensweisen nicht weitergeht. Und viele andere haben mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass es gut funktioniert.
Was ich als große Stärke sehe: Agiles Arbeiten ist wertebasiert, es gibt fünf zentrale Werte. Das Konzept geht mit Respekt einher, mit Selbstverantwortung und Mut – dem Mut, Probleme anzusprechen und Dinge anders zu machen. Weiterhin spielt Transparenz eine große Rolle. Allen Beteiligten ist jederzeit klar, wer aus welchem Grund gerade woran arbeitet. Und nicht zuletzt ist der Fokus von Bedeutung: Man konzentriert sich auf das, was innerhalb eines definierten Zeitraums erledigt sein muss.
Diese Werte würden wahrscheinlich die meisten Menschen teilen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber die Praxis zeigt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Werte zu leben. Gehen wir wirklich transparent miteinander um oder horten wir Wissen? Übernehmen wir Verantwortung oder sagen wir einfach, das betrifft mich nicht? Und fokussieren wir uns wirklich auf die Kernaufgabe oder schweifen wir ständig nach rechts und links ab?
Der Fokus bezieht sich beim agilen Arbeiten auch auf bestimmte Zeiträume, sogenannte Sprints. Was hat es damit auf sich?
Sprints ermöglichen die Entwicklung in kurzen Zyklen. Sie dauern üblicherweise zwei oder vier Wochen. Je nach Erfahrungen kann man diesen Rhythmus auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Entscheidend ist, dass es diese klar definierten Zeiträume gibt, in denen sich die Beschäftigten klar definierten Entwicklungsschritten und Aufgaben widmen.
Man sagt nicht: Liefert bitte innerhalb eines halben Jahres das fertige Produkt. Im Gegenteil, nach jedem Sprint erfolgt ein Austausch mit allen Beteiligten. Dadurch kann weniger schiefgehen. Führungskräfte, Auftraggeber und die Beschäftigten selbst haben immer wieder die Möglichkeit zu sagen, was gut läuft, ob sich Probleme offenbaren und wo gegebenenfalls Ressourcen fehlen. Der Austausch dient dann auch dazu, die Ziele und Inhalte für den nächsten Sprint zu besprechen. Dann beginnt der Prozess von vorn.
Dieses schrittweise Vorgehen, auch iteratives Vorgehen genannt, bildet den Kern der agilen Arbeitsweise. Es sichert den Fokus und ermöglicht gleichzeitig Flexibilität, um sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, die bei der Planung noch nicht präsent waren.
Die Frage ist ja immer auch, woran man am Ende gemessen wird: Am Einhalten eines starren Plans oder an stimmigen Ergebnissen?
Kerstin Sarah von Appen
Effizienz ist ein Thema, das den öffentlichen Dienst beschäftigt. Wie kann agiles Arbeiten Effizienz fördern?
Das schrittweise Vorgehen hilft dabei, mögliche Anpassungen integrieren zu können und verhindert, dass Beschäftigte in die falsche Richtung arbeiten – das ist für die Effizienz von enormer Bedeutung! Und die Frage ist ja immer auch, woran man am Ende gemessen wird: Am Einhalten eines starren Plans oder an stimmigen Ergebnissen? Letzteres ist das, worauf es im Endeffekt ankommt.
Viele bringen Effizienz vor allem mit Wirtschaftlichkeit in Verbindung.
Agiles Arbeiten hilft, schnell greifbare Ergebnisse zu haben, das trägt sicher auch zur Wirtschaftlichkeit bei.
Aber viel wichtiger ist: Vor allem wirkt es sich positiv auf die Beschäftigten aus! Der regelmäßige Austausch, mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen, steigert den Zusammenhalt und die Motivation. Die Beschäftigten sind eigenverantwortlich an den Themen dran und spüren den Fortschritt. Damit geht eine offene Fehlerkultur einher, weil regelmäßige Anpassungen schon Teil des Prozesses sind. Und wenn dann auch noch ein respektvoller Umgang und Transparenz im Arbeitsalltag gelebt werden, ist viel gewonnen.
Stellen wir uns vor, eine Behörde will einen neuen Service etablieren. Wie profitieren die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie dabei agil vorgeht?
Ich habe schon sehr positive Erfahrungen mit Behörden gemacht. Mitunter hat die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern aber etwas sehr Regelhaftes, frei nach dem Motto: Sie müssen sich jetzt so und so verhalten, und dieses und jenes tun.
Das agile Arbeiten beinhaltet, dass die Zielgruppe, für die ein Service bestimmt ist, eingebunden wird. Man ist offen dafür, dass möglicherweise herauskommt: Nein, das ist noch nicht das Ergebnis, mit dem die Menschen zufrieden sind. Wenn Behörden diesen Aspekt konsequent mitdenken, weht ein konstruktiver Wind durch die Flure, von dem alle profitieren!
Was steht agilen Arbeitsweisen – jenseits von starren Strukturen – im Wege?
In der Organisationsentwicklung sprechen wir von verschiedenen Fallen. Eine davon ist die sogenannte Erfahrungsfalle. „Das haben wir doch immer schon so gemacht“ – mit diesen Worten lässt sich die Falle prägnant zusammenfassen. Die damit einhergehende Haltung kann man mit einem Waldweg vergleichen, den man immer wieder entlangläuft. Man kennt sich aus, aber vergisst, mal nach links und rechts zu schauen, verliert den Blick für neue Wege, die möglicherweise besser sind. Das ist im Übrigen ein Phänomen, dem man nicht bloß im öffentlichen Dienst, sondern auch in der freien Wirtschaft begegnet.
Auf einzelne Personen bezogen heißt das zum Beispiel: Der eine lässt sich möglicherweise nicht so gerne in die Karten schauen und hat ein Problem damit, Wissen zu teilen und seine Arbeitsschritte offenzulegen. Und der andere empfindet in dem Moment, in dem Beschäftigte plötzlich sehr frei arbeiten sollen, einen Kontrollverlust. Das gilt vor allem für Führungskräfte, die zum Mikromanagement neigen.
Ein wichtiges Schlagwort ist sicher auch Absicherungsdenken, also die Angst, etwas falsch zu machen. Daraus folgende Absicherungsschleifen gehen zulasten der Agilität.
Aber gerade in der Verwaltung spielt die Einhaltung von Gesetzen eine zentrale Rolle – da müssen gewisse Absicherungsmechanismen greifen. Bürokratie soll, das ist zumindest ein Ideal, auch Verlässlichkeit schaffen und so vor Willkür schützen.
Klar ist natürlich, dass Recht und Gesetz jederzeit eingehalten werden müssen. Und klar ist auch, dass agile Arbeitsweisen sich nicht für alle Bereiche eignen. Es gibt immer – in Unternehmen, Behörden und Organisationen – Prozesse, die über längere Zeit gewachsen sind, gut und verlässlich funktionieren und ihre Berechtigung haben. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen es sich lohnt, die besagten alten Wege zu verlassen. Vor allem, wenn es darum geht, Neues zu entwickeln, zum Beispiel einen neuen Service.
Führungskräfte haben die Aufgabe, den Beschäftigten Orientierung und Rückenwind zu geben.
Kerstin Sarah von Appen
Welche Rolle spielen Führungskräfte, wenn es darum geht, agile Arbeitsweisen zu etablieren?
Sie spielen die entscheidende Rolle, weil sie es sind, die hinter den neuen Arbeitsweisen stehen müssen und neue Herangehensweisen vorleben. Und das bestenfalls, indem sie die Beschäftigten mitnehmen, neue Wege aufzeigen, in nachvollziehbaren Schritten vorgehen und Feedback einholen.
Agilität lässt sich also idealerweise mit Agilität umsetzen?
Sozusagen! Es ist wirklich wichtig, dass sich auch Top-Level-Führungskräfte mit dem Konzept befassen. Sonst funktioniert es nicht oder wird falsch verstanden. Führungskräfte müssen innerhalb der Sprints loslassen können und die Teams arbeiten lassen. In den Besprechungen am Ende eines jeden Sprints ist es wiederum ihre Aufgabe, ausdrücklich auch kritische Fragen zu stellen: Funktioniert es wirklich? Haben wir den Fokus noch im Blick? Oder müssen wir umdenken?
Ob agiles Arbeiten gelingt, ist vor allem eine Frage der Haltung! Die Haltung ist nicht: „Seht zu, dass ihr auch ja alles richtig macht!“ Sondern vielmehr: „Hey, wie läuft es gerade? Habt ihr alles, was ihr braucht?“ Führungskräfte haben die Aufgabe, den Beschäftigten Orientierung und Rückenwind zu geben.
Nehmen wir an, eine Führungskraft steht agilem Arbeiten abweisend gegenüber, aus Sorge davor, dass die Disziplin abhandenkommt. Was entgegnen Sie?
In meine Seminare kommen die Teilnehmenden oft mit der Erwartungshaltung: „Wir sind hier jetzt mal total kreativ, wie cool, alles ganz agil …“ Da muss ich korrigieren: Ja, Kreativität und Freiheit haben durchaus ihren Platz, aber immer innerhalb eines bestimmten Rahmens. Fakt ist: Agiles Arbeiten ist sehr strukturiert und erfordert sogar sehr viel Disziplin! Vor allem mit Blick auf die Erledigung der Aufgaben innerhalb eines Sprints. Oder wenn es darum geht, die eigenen Fortschritte transparent zu machen …
… dabei haben die meisten wahrscheinlich Flipcharts mit bunten Klebezetteln vor Augen, die ein Projekt abbilden. Wie können digitale Tools helfen, agiles Arbeiten umzusetzen?
Für die Kommunikation von Beschäftigten untereinander haben sich Tools wie Teams und Slack inzwischen flächendeckend etabliert, für das Projektmanagement gibt es beispielsweise Trello und Jira. Alle Tools lassen sich nutzen, um Aufgaben zu verteilen, Fortschritte abzubilden, Prioritäten zu verschieben und Informationen zu teilen – kurzum: alles, was agilen Arbeitsweisen entgegenkommt.
Außerdem tragen die Tools auch dem Bedürfnis nach mobilem Arbeiten Rechnung. Trotzdem ist es meiner Erfahrung nach wichtig, dass Teams auch zu Treffen in Präsenz zusammenkommen – dann auch gerne mit den klassischen Flipcharts und bunten Klebezetteln! Der persönliche Kontakt stärkt den Zusammenhalt.
Und was man nicht vergessen darf: Alle Tools haben nur einen Mehrwert, wenn agiles Arbeiten und Denken schon in den Köpfen verankert ist. Heißt: Die Beschäftigten müssen sie pflegen, regelmäßig ihre Fortschritte eintragen und somit die Transparenz schaffen, die das agile Arbeiten ausmacht.
Die Devise lautet also: erst das Mindset, dann das Tool!
Genau. Agiles Arbeiten ist eine Haltungsfrage.
Mehr entdecken: Was ist eine gute Führungskultur?
Wie schnell sich neue Arbeitsweisen umsetzen lassen, hängt von vielen Faktoren ab – zum Beispiel vom Status quo der Arbeitskultur in einem Unternehmen, einer Behörde, einer Organisation. Gibt es Erfahrungswerte, die Sie teilen können? Wie lange dauert die Umstellung?
Meine Erfahrung ist, dass ein tiefgreifender Kulturwandel Zeit braucht, da sprechen wir nicht von Monaten, eher von Jahren. Eingespielte Denk- und Arbeitsweisen zu verändern, neue etablieren, diese einüben und vor allem dranbleiben – das dauert. Aber meine Erfahrung ist auch: Veränderungen lassen sich oft schneller umsetzen als man denkt! Mitunter stellen sich erste Erfolge innerhalb von Wochen ein. Und aus diesen Erfolgen entstehen nicht selten Dynamiken, aus denen sich schnell weitere Schritte ergeben.
Interview: Christoph Dierking