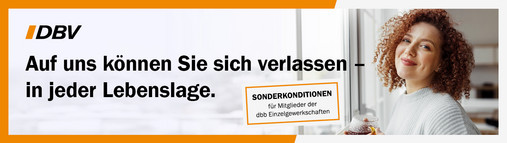-
 Sozialarbeitende haben aktuell nur ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn es in Beratungen um Drogensucht oder Schwangerschaftsabbrüche geht. Foto: Unsplash
Sozialarbeitende haben aktuell nur ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn es in Beratungen um Drogensucht oder Schwangerschaftsabbrüche geht. Foto: Unsplash
Zeugnisverweigerungsrecht Prozess gegen Sozialarbeitende – Klotz: „Es geht um eine Grundsatzfrage!“
Hintergrund des Verfahrens ist eine Eskalation mit Pyrotechnik. Doch es steht mehr auf dem Spiel, betont die Sprecherin des Jungen DBSH.
November 2022, der Karlsruher SC spielt gegen St. Pauli: Vor dem Anpfiff brennen KSC-Fans Pyrotechnik ab. Durch den Rauch werden elf Menschen verletzt, einer davon Medienberichten zufolge schwer.
Die Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass die Fans die Pyrotechnik im Umfeld des Fanprojekts vorbereitet haben. Deshalb möchte sie drei Sozialarbeitende, die zu dem Zeitpunkt dort tätig sind, als Zeugen befragen – diese verweigern allerdings die Aussage. Es folgen Strafbefehle in Höhe von jeweils 120 Tagessätzen, da die Staatsanwaltschaft meint, dass die Sozialarbeitenden die Aussage nicht hätten verweigern dürfen. Inzwischen hat sie Anklage erhoben, wegen Strafvereitelung und unberechtigter Aussageverweigerung.
Im Oktober hat am Amtsgericht Karlsruhe der Prozess gegen die drei Sozialarbeitenden begonnen. Anne Klotz, Sprecherin des Jungen DBSH, verfolgt das Verfahren aufmerksam, auch vor Ort im Gerichtssaal: „Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Kolleg*innen die Aussage verweigert haben“, sagt sie. „Hinter dem konkreten Fall steht eine zentrale Grundsatzfrage für die Soziale Arbeit!“
Mit der Grundsatzfrage meint Klotz das Zeugnisverweigerungsrecht, das in der Sozialen Arbeit nur eingeschränkt gilt.
Warum das ein Problem ist? „Wir arbeiten häufig mit Menschen zusammen, die straffällig geworden sind“, erklärt Klotz. „Vertrauen bildet eine Grundlage für die Soziale Arbeit. Wenn das Gericht die Kolleg*innen verurteilt, hätte das fatale Konsequenzen.“ Denn es würde bedeuten, dass rechtliche Zwangsmaßnahmen entgegengebrachtes Vertrauen jederzeit brechen können, so die Gewerkschafterin.
Kurzum: „Unsere Klient*innen vertrauen uns nicht, wenn sie wissen, dass wir sie im Extremfall vor Gericht verpfeifen müssen.“
Zeugnisverweigerungsrecht: Nicht für alle
Wer mit Beschuldigten in einem Gerichtsverfahren verlobt, verheiratet, verwandt oder verschwägert ist, darf laut aktueller Rechtslage das Zeugnis verweigern (§ 52 StPO). Das gilt auch für Berufsgeheimnisträger*innen, zu denen unter anderem Geistliche, Verteidiger*innen von Beschuldigten, Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen gehören (§ 53 StPO). Hinzu kommen „Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle“, die bei Konflikten in Zusammenhang mit Schwangerschaften beraten, und „Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit“. Das sind in der Praxis oft Sozialarbeitende.
Doch jenseits von Beratungen in Zusammenhang mit Schwangerschaften und Drogenkonsum dürfen Sozialarbeitende die Aussage nicht verweigern. Um das Zeugnisverweigerungsrecht auszudehnen, wäre eine Gesetzesänderung auf Bundesebene notwendig. Konkret: die Aufnahme der Sozialen Arbeit in die geschützten Berufsgruppen (§ 53 Abs. 1 StPO).
Wenn jemand ankündigt, seine Kinder umzubringen, geht die Information natürlich an die Polizei.
Anne Klotz, Sprecherin Junger DBSH
Aktuell sieht es nicht danach aus, dass eine Reform zeitnah zustande kommt: Diese lehnte die Bundesregierung nach einer Anfrage der Linkspartei im vergangenen Jahr ab und verwies auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Demnach müsse „der Kreis der Zeugnisverweigerungsberechtigten auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt werden“. Nur so ließen sich Straftaten effektiv verfolgen, hieß es zur Begründung.
Eine nicht mehr zeitgemäße Argumentation, findet das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit, das seit 2020 für die Änderung des Status quo kämpft. Inzwischen unterstützen mehr als 30 Verbände und Organisationen die Ziele des Bündnisses, darunter der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) und die Deutsche Justiz-Gewerkschaft Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (DJG).
Zudem widerspricht die Arbeiterwohlfahrt (AWO) der Sichtweise der Bundesregierung. Ein Rechtsgutachten des Verbandes kommt zu dem Schluss, dass die aktuelle Gesetzgebung den Aufgaben und der fachlichen Entwicklung der Sozialen Arbeit nicht mehr gerecht wird. Problematisch sei auch der Widerspruch, dass Sozialarbeitende einerseits der gesetzlichen Schweigepflicht unterliegen (§ 203 StGB), andererseits aber in Strafprozessen zur Aussage verpflichtet sind.
Resozialisierung: Jede Information ist wichtig
Klotz hofft, dass die Debatte weiter an Fahrt aufnimmt. „Die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir straffällig gewordene Menschen unterstützen“, betont sie. „Und das können wir am besten, wenn sie uns aus Sorge vor juristischen Konsequenzen keine Informationen vorenthalten.“
Was passiert, wenn schwere Straftaten im Raum stehen? Klotz: „Wenn jemand ankündigt, seine Kinder umzubringen, geht die Information natürlich an die Polizei. Sozialarbeitende sind staatlich geprüft und durchaus in der Lage, im Ernstfall die richtige Entscheidung zu treffen. Diese Kompetenz wird anderen Berufsgruppen, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, im Übrigen auch zugesprochen.“
Mehr entdecken: Junger DBSH fordert Zeugnisverweigerungsrecht für Soziale Arbeit
Mit Blick auf den Prozess in Karlsruhe hofft die Sprecherin des Jungen DBSH, dass er zugunsten der drei angeklagten Sozialarbeitenden ausgeht. „Eine Verurteilung hätte eine abschreckende Wirkung auf Berufseinsteiger*innen. Sozialarbeitende sollen im geschützten Raum ihre Arbeit machen können. Es ist nicht hinnehmbar, dass sie sich im Extremfall zwischen beruflicher Integrität und rechtlichen Konsequenzen entscheiden müssen.“
Redaktion: cdi
++ Update ++
Am 29. Oktober 2024 hat das Amtsgericht Karlsruhe die Sozialarbeitenden des Fanprojekts wegen Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Dadurch gelten die Verurteilten nicht als vorbestraft.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte in ihrem Plädoyer mit der Schwere des Vorfalls und hob hervor, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf effektive Strafverfolgung habe. Sie forderte eine Strafe von 160 Tagessätzen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und darauf verwiesen, dass die Sozialarbeitenden ohne Genehmigung des Arbeitgebers – der Stadt Karlsruhe – gar nicht hätten aussagen dürfen. Eine solche Genehmigung sei nicht eingeholt worden. Außerdem seien die Täter zu dem Zeitpunkt, als die Sozialarbeitenden die Aussage verweigerten, längst bekannt gewesen. Deshalb hätte es gar nicht zum Verfahren kommen dürfen.
Die Sozialarbeitenden wollen das Urteil nicht hinnehmen und in Berufung gehen, entsprechend geht das Verfahren voraussichtlich vor dem Landgericht weiter.
Das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit erklärt in einer Pressemitteilung: „Sozialarbeiter*innen sind bundesweit entsetzt. Weil sie das besondere Vertrauensverhältnis zu ihrer Zielgruppe, wohl dem zentralen Grundpfeiler der Sozialen Arbeit, nicht auf das Spiel setzen konnten und wollten, wurden drei hauptamtliche Mitarbeitende des Fanprojekts Karlsruhe vor dem Amtsgericht zu hohen Geldstrafen verurteilt. Und dies, weil sie kein Zeugnisverweigerungsrecht besitzen.“
Anne Klotz, Sprecherin des Jungen DBSH, kommentiert: „Schweigepflicht ist kein Verbrechen! Das Urteil gegen unsere Kolleg*innen ist ein gefährlicher Präzedenzfall für die Soziale Arbeit. Die Politik sollte stattdessen handeln und die Sozialarbeit endlich mit einer Reform des Zeugnisverweigerungsrechts absichern.“