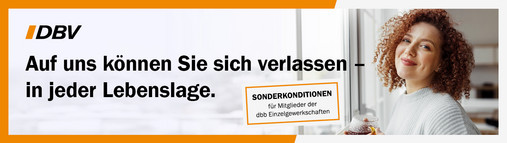-
 Waldbrände gehören zu den schwierigsten Disziplinen der Brandbekämpfung. Foto: Fabian Jones/Unsplash
Waldbrände gehören zu den schwierigsten Disziplinen der Brandbekämpfung. Foto: Fabian Jones/Unsplash
Feuer im Wald Was es bedeutet, einen Waldbrand zu bekämpfen
Wind, Hitze, unzugängliches Gelände: Wenn der Wald brennt, steht die Feuerwehr vor enormen Herausforderungen. Und das Risiko steigt.
Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) kommt es in Deutschland im Durchschnitt zu etwa 1.000 Waldbränden im Jahr. Dabei brennen etwa 800 Hektar Wald ab – das entspricht einer Fläche von ungefähr 1.120 Fußballfeldern. Die Behörde ist angesichts des Klimawandels alarmiert, denn mit ihm gehen lange Trockenperioden einher.
„Die Temperaturen steigen, der Wald trocknet bereits im Frühjahr aus und wird anfälliger“, sagt Valentino Tagliafierro, Berufsfeuerwehrmann aus Duisburg und bei der komba gewerkschaft zuständig für den Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst. In dieser Funktion besucht er bundesweit Feuerwehrwachen, um zu hören, wo bei den Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt.
Waldbrände rücken zunehmend in den Fokus. Im Juli brannte es in der Gohrischheide in Sachsen, die Forstverwaltung sprach vom „größten Feuer seit Jahrzehnten“. Das Ausland ist ebenso betroffen: etwa das Umland der spanischen Hauptstadt Madrid, auch in der Nähe der französischen Metropole Marseille und der kroatischen Küstenstadt Split loderten in diesem Jahr bereits die Flammen. Für den Gewerkschafter steht fest: „Waldbrände gehören ganz klar zu den schwierigsten Disziplinen der Brandbekämpfung!“
Wie bekämpft man einen Waldbrand?
Wo es brennt, ist nicht notwendigerweise Löschwasser verfügbar – ein Problem, mit dem die Feuerwehr auch an anderen Einsatzorten konfrontiert ist, unter anderem auf Autobahnen.
Insbesondere bei Waldbränden sind die Löschwasserkapazitäten, die Einsatzfahrzeuge mit sich führen, schnell erschöpft. „Ab einem gewissen Punkt bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schläuche auszurollen“, erklärt Tagliafierro, der einen Vegetationsbrand an einem Bahndamm noch in guter Erinnerung hat. Damals erstreckte sich das Feuer über eine Strecke von mehreren Kilometern. Die Feuerwehr musste in regelmäßigen Abständen Pumpen beziehungsweise Einsatzfahrzeuge mit Pumpen zwischenschalten, um den Wasserdruck aufrechtzuerhalten. „Sonst wäre vorne nur ein Pipi-Strahl herausgekommen, mit dem sich nichts ausrichten lässt.“
Bei der Waldbrandbekämpfung zapft die Feuerwehr gegebenenfalls auch Seen an. Sie ist ebenfalls befugt, Wasser aus privaten Gartenteichen oder Swimmingpools für den Löscheinsatz zu verwenden. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, ziehen die Einsatzkräfte Brandschneisen. Heißt: Sie entfernen an strategisch günstigen Orten Vegetation und entziehen dem Feuer so die Nahrung.
Ohne ehrenamtliche Kräfte geht es grundsätzlich nicht. Aber vor allem bei Waldbränden ist ihre Unterstützung von enormer Bedeutung.
Valentino Tagliafierro
Was macht die Waldbrandbekämpfung so schwierig?
Logistik. Löschflugzeuge und Hubschrauber stellen im schwer zugänglichen Gelände mitunter die einzige Option dar, ein Feuer einzudämmen. Tagliafierro: „Hubschrauber sind wegen ihrer Manövrierfähigkeit sehr gut geeignet. Sie sind in der Lage, nicht nur Löschwasser, sondern gegebenenfalls auch Personal und Material zum Einsatzort zu fliegen.“
Wetter. Starke Winde führen zur raschen Ausbreitung des Feuers und können den Kampf gegen die Flammen mitunter hoffnungslos erscheinen lassen. „Wenn der Wind dreht, steht man plötzlich mitten im Rauch und sieht nichts mehr“, berichtet der Feuerwehrmann. „Eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist“ – generell spielt die Eigensicherung eine große Rolle. Die Flammen sollen niemanden einschließen.
Belastung. Die Hitze kommt von allen Seiten, die Einsatzkräfte mittendrin. Selbst wer gut trainiert ist, stößt schnell an körperliche Grenzen. „Die Einsatzleitung muss das Personal regelmäßig tauschen“, unterstreicht Tagliafierro. „Ohne ehrenamtliche Kräfte geht es grundsätzlich nicht. Aber vor allem bei Waldbränden ist ihre Unterstützung von enormer Bedeutung.“
Kontaminierte Böden. Es kommt vor, dass Waldgebiete mit Munition belastet sind. So war es zuletzt beim Feuer in der sächsischen Gorischheide. Immer wieder explodierte Munition, laute Knalle schallten über das betroffene Gebiet. In solchen Fällen sind die Möglichkeiten der Feuerwehr am Boden stark begrenzt, weil die Eigensicherung noch stärker in den Fokus rückt – stärker als ohnehin schon.
Wie organisieren die Behörden die Waldbrandbekämpfung?
Zuständig für die Brandbekämpfung ist die Stadt beziehungsweise Kommune, in deren Einzugsgebiet es brennt. Es besteht die Option, bei Bedarf Amtshilfe anzufordern – bei den benachbarten Städten oder Kommunen oder auch beim Bund, der mit Kräften der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und mit Hubschraubern der Bundespolizei unterstützen kann.
Das THW leistet vor allem logistische Hilfe. „Wenn die Löscharbeiten lange andauern, muss man die Versorgung gewährleisten“, betont Tagliafierro. Diese erfolgt über spezielle Versorgungscontainer, die in der Nähe des Einsatzortes aufgestellt werden. Auch Hygiene ist wichtig. Die Feuerwehrleute müssen die Möglichkeit haben, sich zu waschen, um giftige Rußpartikel von der Haut zu entfernen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Dreh- und Angelpunkt der Einsatzkoordination ist der Krisenstab. Ein Krisenstab setzt sich aus mehreren Stäben zusammen, die sich jeweils um eine bestimmte Aufgabe kümmern, darunter Personal, Verpflegung, Pressearbeit und das Monitoring des Wetters. Alle Beteiligten kommen in bestimmten Zeitintervallen, deren Abstände sich nach der Lage richten, zusammen und erstatten Bericht. Die Leitung des Krisenstabs hat in der Regel die Bürgermeisterin beziehungsweise der Bürgermeister inne.
Ein Feuer richtet sich nicht nach Zuständigkeitsgrenzen. Ein Krisenstab agiert immer mit Blick auf den Bereich, der von der Krise betroffen ist. Je größer das betroffene Gebiet, desto höher ist ein Krisenstab angesiedelt. Bei überregionalen Lagen kann ein Bundesland das Katastrophenmanagement direkt an sich ziehen und einen Landeskrisenstab einrichten.
Reichen die nationalen Ressourcen nicht aus, besteht die Möglichkeit, das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union zu aktivieren, berichtet Tagliafierro. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit unterstützen Löschfluge und Feuerwehrkräfte aus dem Ausland.
Wie müssen sich die Behörden aufstellen?
Städte und Kommunen statten ihre Feuerwehr im Idealfall immer so aus, dass sie auf alle im Einsatzgebiet möglichen Szenarien vorbereitet sind, erklärt der Gewerkschafter. Heißt: Wenn es viel Wald gibt, sollten beispielsweise geländegängige Fahrzeuge mit Allradantrieb zur Verfügung stehen. „Außerdem leisten Drohneneinheiten, die Brandherde und Glutnester aus der Luft identifizieren können, wertvolle Aufklärungsarbeit.“
Mehr entdecken: Wie sich der Staat auf Krisen einstellt
Tagliafierro ist mit Feuerwehrleuten aus ganz Europa vernetzt, unter anderem aus Frankreich und Griechenland. „Es entstehen Situationen, in denen mehrere Länder gleichzeitig auf europäische Unterstützung angewiesen sind“, sagt er. Deshalb sei es wichtig, die Mittel für weitere Ressourcen aufzustocken. „Wer ein Löschflugzeug anfordert, möchte auf keinen Fall zu hören bekommen, dass aktuell keins mehr verfügbar ist. Situationen wie diese müssen wir um jeden Preis vermeiden.“
Text: Christoph Dierking