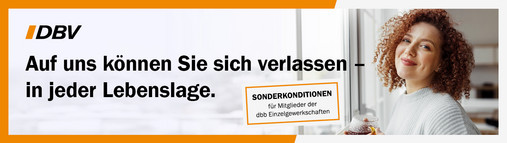Interview Experte fordert: „Es muss schneller gehen bei Gewalttaten“
Wer Körperverletzungen begeht, soll schnell vor Gericht kommen – dem misst der Gewaltforscher Ulrich Wagner eine hohe Bedeutung bei. Ebenfalls Prävention ist entscheidend. Was der Staat tun kann, schildert er im Interview.
Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind häufig Angriffen ausgesetzt. Eine Studie des Bundesinnenministeriums kommt zu dem Ergebnis: Jeder und jede Vierte erlebt Gewalt, darunter verbale Beschimpfungen, Rangeleien, sogar das Bewerfen mit Fäkalien kommt vor. Längst ist bekannt, dass nicht nur die Polizei mit gefährlichen Situationen rechnen muss. Warum kommt es zu so vielen Übergriffen? Und wie kann es gelingen, Staatsbedienstete besser vor Gewalt zu schützen?
Diese Fragen hat die dbb jugend nrw Ulrich Wagner gestellt, Sozialpsychologe und Seniorprofessor an der Philipps-Universität Marburg. Er forscht zu Gruppenkonflikten, Aggression und Gewalt. Als Präventionsexperte und Gutachter ist er bundesweit tätig.
#staatklar: Herr Wagner, aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 geht hervor, dass Fälle von physischer Gewalt in den vergangenen 15 Jahren zurückgegangen sind. Deshalb erstaunt es, dass im Gegensatz dazu die Zahl von Übergriffen auf Polizist*innen, Mitarbeitende des Ordnungsamts und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst zugenommen hat. Wie kann das sein?
Ulrich Wagner: Meist steht dahinter der Verlust einer – wissenschaftlich ausgedrückt – normativen Vorstellung darüber, wie man mit Gewalt umgeht. Es lässt sich beobachten, dass manche Gruppen Antigewaltnormen nicht mehr so teilen, wie das gesellschaftlich eigentlich der Fall ist, und das spiegelt die Polizeiliche Kriminalstatistik.
Warum ist das so?
Es hat etwas damit zu tun, inwieweit Menschen sich selber als Mitglied unserer Gemeinschaft, des Staatswesens, ansehen und damit die Normen dieses Staatswesens insgesamt anerkennen. Oder ob sie den Eindruck haben: Das ist etwas anderes, das hat mit mir nicht so richtig zu tun und deswegen kann ich mich auch abweichend – in dem Fall gewalttätig – verhalten.
Aber was führt dann dazu, dass sich Menschen gewalttätig verhalten?
Es ist anzunehmen, dass es einen Teil in unserer Gesellschaft gibt, der glaubt, nichts davon zu haben, sich normkonform zu verhalten. Gegen allgemeine Regeln verstoßen Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Ich konstruiere mal ein extremes Beispiel: Ein Mensch mit Aufenthaltsgenehmigung, dessen Aufenthaltsstatus hier ausläuft, bei dem klar ist, dass er abgeschoben wird – warum sollte ein solcher Mensch sich normkonform verhalten?
Natürlich bedeutet das nicht, dass sich alle Menschen, die in einer solchen Situation sind, nicht normkonform verhalten. Ich beziehe das nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben auch andere Menschen in der Gesellschaft, die das Gefühl haben, nicht richtig mitmachen zu können. Und da läuft etwas falsch.
Wir reden hier über Gewaltübergriffe. Meinen Sie damit auch verbale Gewalt?
Nein. Meine Definition von Gewalt ist die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und deren Androhung. Da wird jemand verfolgt bis zur Haustür – der wäre auch in meiner Gewaltdefinition drin. Aber wenn jemand dem Schaffner sagt „Du Arsch!“, dann ist das eine üble Beschimpfung, aber es ist keine Gewaltandrohung. Ich glaube, das macht auch mit dem Schaffner etwas anderes als eine Bedrohung oder ein körperlicher Angriff. Deshalb halte ich das für wichtig, das auseinanderzuhalten.
Sind verbale Ausraster also gar nicht so schlimm?
Ich möchte Beschimpfungen nicht bagatellisieren. Aber physische Gewalt hat im Unterschied zu verbaler Gewalt andere Konsequenzen für den Schaffner und auch die Ursachen sind unterschiedliche. Deshalb lege ich so großen Wert darauf, das auseinanderzuhalten. Und der juristische Umgang mit physischer Gewalt und Beleidigung sollte auch unterschiedlich sein.
Was meinen Sie damit?
Ich bin schon seit Jahren unzufrieden damit, dass physische Gewalt vor Gerichten nicht bevorzugt behandelt wird. Wenn jemand zusammengeschlagen wird, dann muss der Staat die Täter unmittelbar zur Verantwortung ziehen. Wenn jemand beschimpft wird, ist das auch übel und dem ist ebenfalls nachzugehen, aber das hat nicht dieselbe Dringlichkeit. Dabei ist es psychologisch betrachtet gar nicht so wichtig, wie hoch die Strafe ist. Viel wichtiger ist, dass die Strafe möglichst unmittelbar auf die Tat erfolgt. Gerade im Jugendstrafrecht dauert es jedoch manchmal ewig, und die jugendlichen Täter können sich, wenn es endlich zum Prozess kommt, schon gar nicht mehr erinnern, worum es eigentlich geht. Das darf nicht sein. Es muss schneller gehen bei Gewalttaten. Dies setzt allerdings hinreichende Stellenausstattung vor allem im Bereich der Staatsanwaltschaften und Gerichte voraus.
Das erweckt jetzt den Anschein, als seien die meisten Täter jung. Ist das so?
Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 zeigt einen Anstieg bei Gewalttaten ab einem Alter von 16 bis 18 Jahren und dann bis circa 26 Jahre. Ab 28 wird es weniger. Wenn wir über physische Gewalt reden, sprechen wir fast immer über junge Männer.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen aus allen Alters- und Bevölkerungsschichten Übergriffe auf Kolleg*innen im Öffentlichen Dienst verüben.
Natürlich gibt es solche Situationen: überfüllte Klinik, Eltern mit Kleinkind, Atembeschwerden, kommen in der Notaufnahme nicht dran, weil sie völlig überlaufen ist. Das ist eine Situation, in der es zuweilen zu Ausrastern und Beschimpfungen kommt. Vielleicht sogar zu Übergriffen. Aber ich glaube, dass es im Vergleich zu den anderen beschriebenen Situationen selten ist, dass sich dort physische Übergriffe ereignen.
In vielen Behörden gibt es präventive Sicherheitskonzepte oder Anti-Gewalt-Erklärungen. Welche Maßnahmen halten Sie für wichtig, um die Situation zu verbessern?
Über das Thema „unmittelbare Bestrafung von überführten Gewalttätern“ durch die Gerichte sprachen wir schon. Langfristig wirksamer und kostengünstiger als Strafverfolgung und Sanktionierung ist Prävention, die Menschen dazu bringt, freiwillig und aus Überzeugung soziale Normen einzuhalten und sich gewaltfrei zu verhalten.
Dazu eignen sich beispielsweise Trainings zur Konfliktbewältigung in den Schulen oder Anti-Aggressionstrainings für junge Männer – auch für bereits überführte Straftäter im Strafvollzug. Das Problem: Solche Trainings in Schulen und Berufsschulen sind oft zeitlich befristet. Es muss gelingen, die Angebote besser zu verknüpfen, beispielsweise durch Sportvereine oder Maßnahmen des Jugendamtes oder freie Träger.
Außerdem müssen wir die Prävention noch breiter anlegen. Wenn die beschriebenen Gewaltausbrüche gegen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei darauf zurückgehen, dass die Täter in unsere Gesellschaft zu wenig eingebunden sind und Normen zur Gewaltfreiheit nicht verstehen oder nicht akzeptieren wollen, müssen wir für diese Menschen Partizipationsangebote machen. Menschen, die keine laute Stimme oder viel Geld haben oder aus anderen Gründen nicht dazugehören, müssen wir in die Gemeinschaft einbeziehen. Auch sie wollen zum Beispiel an der kommunalen Entwicklung und der des eigenen Umfelds beteiligt sein. Das ist eine wichtige Aufgabe der kommunalen Entwicklungsplanung. Ich nenne das „Prävention durch Partizipation“.
Was ist ein Beispiel für eine konkrete Maßnahme?
Ich komme gerade von einer Konferenz, in der wir Maßnahmen diskutieren: Wie kann man kommunales Konfliktmanagement so gestalten, ohne dass die Konflikte eskalieren? Da gibt es Möglichkeiten. Wie kann man Plätze so gestalten, dass junge Leute etwas davon haben, ohne dass es der Anwohnerschaft auf den Wecker gehen muss, weil es nachts um vier Uhr noch laut ist? Solche Möglichkeiten zur Teilhabe brauchen wir.
Was sind weitere Ideen?
Sicherlich lässt sich auch durch Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst etwas erreichen. Indem diese noch viel stärker lernen, sich deeskalierend zu verhalten. Ich weiß, dass es eine merkwürdige Forderung ist, dem Opfer die Pflicht anzudienen, die Situation zu deeskalieren. Aber ich sehe darin Potenzial. Wie kann man damit umgehen, wenn im Sozialamt der ablehnend beschiedene Empfänger lauter und immer lauter wird?
Viele Beschäftigte können es sich in Anbetracht überquellender Schreibtische zeitlich gar nicht einrichten, zusätzlich solche Trainings zu besuchen. Auch finden sie zu selten statt.
Natürlich schränkt Überlastung die Freiräume für solche Trainings drastisch ein. Und die Überlastung ist auch in anderer Hinsicht ein Problem: Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern nur kurz angebunden sind, um einen Fall zu bearbeiten, dann ist das natürlich für Kund*innen nicht spaßig und erhöht das Konfliktpotenzial. Es trägt zu Eskalation bei.