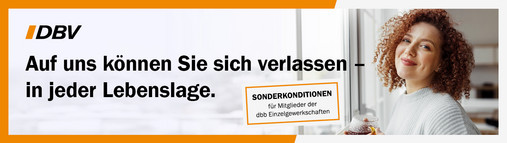Sorge um den Klimaschutz Lauter Protest für die Zukunft
Festgeklebte Aktivist*innen, Kartoffelbrei auf Kunstwerken und Großdemonstrationen sind heute Werkzeug im Kampf gegen die Klimakrise. Was hilft der Protestbewegung für mehr Klimaschutz wirklich?
Berlin steht im April für eine Woche still – das ist zumindest das ursprüngliche Ziel. In Bussen, Bahnen und auf der Straße sind oft Gespräche und Diskussionen über die Proteste der „Letzten Generation“ zu hören. „Glaubst du, jemand würde sie einfach überfahren?“, überlegen zwei Jugendliche in der Tram. Viele Menschen sind von den Blockaden der Klimaaktivist*innen, die sich auf Hauptverkehrsstraßen festkleben, genervt. Die Politik spricht zunehmend von rechtswidrigen und strafbaren Aktionen.
Frust über die Klimakrise herrscht schon lang; darum organisiert und mobilisiert sich die Jugend, um auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen. „Extinction Rebellion“, die „Letzte Generation“ und „Fridays For Future“ – in den vergangenen Jahren sind diese drei Protestbewegungen öffentlichkeitswirksam in Erscheinung getreten, vereint durch ein gemeinsames Ziel: den Klimaschutz. Alle verbindet das Gefühl der Ohnmacht angesichts einer Politik, die Klimaziele ihrer Meinung nach zu zaghaft verfolgt.
Schulstreik und Sitzblockaden
Was die Protestform betrifft, unterscheiden sich die drei Bewegungen: Schulstreiks und eindrucksvolle Großdemonstrationen, das waren die Markenzeichen von „Fridays For Future“. „Extinction Rebellion“ setzten in der Regel auf friedliche Sitzblockaden.
Die umstrittensten Protestformen kommen von der „Letzten Generation“. An ihren Aktionen scheiden und empören sich die Geister. Kartoffelbrei-Attacken auf Monets „Heuhaufen“, Festkleben auf Autobahnen – die Klimaaktivist*innen der „Letzten Generation“ etablieren vollkommen neue Protestformate. Die Gesellschaft ist sich angesichts dieser neuen Eskalationsstufe uneins: Bringen solche Aktionen überhaupt etwas? Oder wird der Zusammenhalt, der Konsens, dass die Politik generell mehr für den Klimaschutz tun muss, dadurch gespalten?
Eine NDR-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass junge Menschen die Proteste zu 51 Prozent für angemessen halten. Eine deutliche Mehrheit – 72 Prozent – der über 29-Jährigen hingegen hält die Protestformen für unangemessen.
Ziviler Ungehorsam verschafft Gehör
Ihre Aktionen rechtfertigt die „Letzte Generation“ mit der Dringlichkeit des Klimaschutzes. Es sei Zeit für die Menschen und die Politik, mehr zu tun. Denn die Notsituation bekämen vor allem die Jugendlichen zu spüren. Dies sei nicht nur ein Problem der Zukunft. Schon jetzt – das geht aus einer Studie des Umweltbundesamts hervor – habe die Klimakrise psychische Auswirkungen auf die Mehrheit der jungen Menschen. Emotionen wie Angst, Wut, Trauer und das Empfinden von Ungerechtigkeit stünden dabei im Mittelpunkt. Durch zivilen Ungehorsam verleiht die „Letzte Generation“ diesen Gefühlen Ausdruck und verschafft ihnen Gehör.
Protestforscherin: „Störfaktor, der das Normale unterbricht“
Solche Aktionen seien die Konsequenz daraus, dass bisher keine angemessenen Schritte für den Klimaschutz eingeleitet würden, sagt Protestforscherin Lena Herbers, die an der Universität Freiburg zu sozialen Bewegungen und zivilen Ungehorsam forscht. Die Protestierenden der „Letzten Generation“ hätten es geschafft, die Klimakrise medial in den Mittelpunkt zu rücken. „Sie bilden einen Störfaktor, der das Normale unterbricht. Je radikaler die Notwendigkeit des Klimaschutzes, desto radikaler die Protestformen“, sagt die Expertin in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.
Nicht alle müssten hinter den Aktionen der „Letzten Generation“ stehen, könnten sie aber trotzdem als notwendig für die Klimabewegung ansehen, sagt Herbers. Der zivile Ungehorsam sei ein absichtlicher Gesetzesbruch, um die Politik und Regierung zu Änderungen oder Handlungen zu bewegen. Umstritten bleibe er, da er das tägliche Leben der Gesellschaft stören und punktuell auch in Gefahr bringen kann – ein Beispiel sind die Rettungskräfte, die durch einen von Klimaaktivist*innen ausgelösten Stau feststecken. Protestierende der „Letzten Generation“ gehen dieses Risiko bewusst ein, weil sie einen hohen Handlungsdruck verspürten, berichtet Herbers. Ob sie die Gesellschaft damit spalte, bleibt Gegenstand weiterer Diskussionen.
Psychologe: „notwendige Metamorphose des Protests“
Der Psychologe Stephan Grünewald erläuterte in einem Interview mit der Tageszeitung „taz“, wieso es radikalere Proteste trotz aller berechtigter Einwände brauche. Eine Studie des „Rheingold Institut“ habe gezeigt, dass viele Menschen stark mit den Protesten von „Fridays For Future“ sympathisierten. Das erfreute die jungen Menschen, weil die älteren, die die Macht besäßen etwas zu ändern, endlich zuhörten und zustimmten. Die ältere Generation hingegen begrüßte es, dass die Jungen auf das Problem hinwiesen. Wenn sie später die Kompetenz und Macht dazu haben, kümmern sie sich um das Klimaproblem. Somit waren sich alle über die Betroffenheit einig, aber die Verantwortung wurde vom einen auf den anderen und damit in die Zukunft geschoben. Deshalb sei die „Letzte Generation“ „eine notwendige Metamorphose des Protests“, erklärte Grünewald.
Fridays for Future: „Spaltung der Gesellschaft“
Unverständnis für die Aktionen der „Letzten Generation“ kommt mittlerweile auch aus den eigenen Reihen der Klimaschutzbewegung. „Fridays For Future“-Sprecherin Annika Rittmann warf den Protestierenden vor, mit ihren Protestaktionen die Gesellschaft zu spalten. Die Klimakrise brauche gesamtgesellschaftliche Lösungen, und diese ließen sich nur gemeinsam erstreiten und nicht, indem der Protest Menschen im Alltag gegeneinander aufbringt. Anlass für diese Reaktion Rittmanns waren die Blockaden der „Letzten Generation“ in Hamburg, die zu Ostern vor allem Pendler*innen betraf. Das seien Menschen, die es sich nicht leisten könnten, in der Innenstadt zu wohnen oder den ÖPNV zu nehmen, erklärte Rittmann. Diese Menschen nun zusätzlich negativ zu belasten, sei unfair.
Grüne: „elitäre und selbstgerechte Proteste“
Auch die Grünen, Klimapartei schlechthin, sehen die aggressiven Formen des Protests kontraproduktiv. Sie bezeichneten die Aktionen in Hamburg als „elitäre und selbstgerechte Proteste“, die vor allem den materiell benachteiligten Menschen schaden würden. So könne es nicht gelingen, „breite Bewegung in der Gesellschaft für konsequente Klimaschutzpolitik“ zusammenbringen, sagte Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. „Der Klimawandel ist menschengemacht, deshalb braucht es die Menschen, wenn wir ihn, so gut es geht, aufhalten wollen.“
Innenministerin: „Die Klimakrise können wir nur demokratisch bekämpfen“
Bundesinnenministerin Nancy Faeser kritisierte die April-Sitzblockaden der „Letzten Generation“: „Ich habe nicht das geringste Verständnis für die Aktionen“, sagte sie dem „Tagesspiegel“. „Die Klimakrise können wir nur demokratisch bekämpfen.“ Die Ministerin hatte die Aktionen der Gruppe schon mehrmals kritisiert. Die Polizei habe ihre Unterstützung, wenn sie konsequent durchgreifen müsse. Für sie ende legitimer Protest dort, wo Straftaten begangen und andere in ihren Rechten verletzt würden, unterstrich Faeser. Auch die Bundesregierung beurteilt solche Aktionen kritisch, sie hält sie in Sachen Klimaschutz für kontraproduktiv.